Das Chalet der Erinnerungen
Ein Chalet in der Schweiz, wo er früher die Winterferien verbrachte, gehört zu den wichtigsten Kindheitserinnerungen von Tony Judt. Als ihn eine Krankheit ans Bett fesselte, wurde ihm dieses Chalet in schlaflosen Nächten zur inneren Heimat: von hier aus...
lieferbar
versandkostenfrei
Taschenbuch
10.30 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Das Chalet der Erinnerungen “
Ein Chalet in der Schweiz, wo er früher die Winterferien verbrachte, gehört zu den wichtigsten Kindheitserinnerungen von Tony Judt. Als ihn eine Krankheit ans Bett fesselte, wurde ihm dieses Chalet in schlaflosen Nächten zur inneren Heimat: von hier aus unternahm er im Kopf Reisen an die Schauplätze seines Lebens, die er in Prosastücke, in seine Autobiographie verwandelte.
Tony Judt hat mit diesem Buch ein Zeugnis von hoher Intellektualität hinterlassen, das bereits jetzt ein Klassiker der Erinnerungsliteratur ist. Es ist das Vermächtnis eines einzigartigen Intellektuellen, der wie kaum ein anderer unsere Geschichte beobachtete und reflektierte.
"Erfahrene Vielfalt prägt die Erinnerungen dieses großen Historikers." -- Wolf Lepenies, Die Welt
Tony Judt hat mit diesem Buch ein Zeugnis von hoher Intellektualität hinterlassen, das bereits jetzt ein Klassiker der Erinnerungsliteratur ist. Es ist das Vermächtnis eines einzigartigen Intellektuellen, der wie kaum ein anderer unsere Geschichte beobachtete und reflektierte.
"Erfahrene Vielfalt prägt die Erinnerungen dieses großen Historikers." -- Wolf Lepenies, Die Welt
Klappentext zu „Das Chalet der Erinnerungen “
Ein Chalet in der Schweiz, wo er früher die Winterferien verbrachte, gehört zu den wichtigsten Kindheitserinnerungen von Tony Judt. Als ihn eine Krankheit ans Bett fesselte, wurde ihm dieses Chalet in schlaflosen Nächten zur inneren Heimat: von hier aus unternahm er im Kopf Reisen an die Schauplätze seines Lebens, die er in Prosastücke, in seine Autobiographie verwandelte.Tony Judt hat mit diesem Buch ein Zeugnis von hoher Intellektualität hinterlassen, das bereits jetzt ein Klassiker der Erinnerungsliteratur ist. Es ist das Vermächtnis eines einzigartigen Intellektuellen, der wie kaum ein anderer unsere Geschichte beobachtete und reflektierte.
"Erfahrene Vielfalt prägt die Erinnerungen dieses großen Historikers."
Wolf Lepenies, Die Welt
Lese-Probe zu „Das Chalet der Erinnerungen “
Das Chalet der Erinnerungen von Tony JudtVorwort
Eine Veröffentlichung der hier vorliegenden Texte war ursprünglich nicht geplant. Ich habe sie anfangs nur für mich geschrieben, ermuntert auch von Timothy Garton Ash, der mich drängte, meine zunehmend persönlich gefärbten Gedanken nicht für mich zu behalten . Ich glaube nicht, dass mir klar war, worauf ich mich einließ. Ich bin Tim dankbar für den Zuspruch, mit dem er die ersten Ergebnisse begleitet hat.
Nachdem etwa die Hälfte dieser Feuilletons geschrieben war, legte ich meinen Agenten von der Wylie Agency sowie Robert Silvers von der New York Review of Books eine kleine Auswahl vor und fand ihre Begeisterung ermutigend. Für mich warf das jedoch eine ethische Frage auf. Weil ich diese Texte nicht mit Blick auf eine unmittelbare Veröffentlichung geschrieben hatte, waren sie auch nicht redigiert, genauer gesagt von keinem privaten Zensor durchgesehen worden. Wo von meinen Eltern oder meiner Kindheit die Rede ist, von meinen Exfrauen und gegenwärtigen Kollegen, habe ich sie selbst sprechen lassen. Das hat den Vorzug der Unmittelbarkeit. Ich hoffe, ich bin niemandem zu nahe getreten.
An den originalen Texten, die mit Hilfe meines langjährigen Kollegen Eugene Rusyn niedergeschrieben wurden, habe ich nichts geändert, nichts umformuliert. Bei neuerlicher Lektüre fällt mir auf, dass ich gegenüber geliebten Menschen recht offen und gelegentlich sogar kritisch bin, während ich mich bei Menschen, die mir weniger nahe sind, meist höflich zurückgehalten habe . So soll es zweifellos sein. Ich hoffe, dass meine Eltern, meine Frau und besonders meine Kinder in diesen Texten ein weiteres Zeugnis meiner innigen Liebe zu ihnen allen sehen.
1
Das Chalet der Erinnerungen
... mehr
Das Wort »Chalet« löst ein ganz bestimmtes Bild in mir aus Ich sehe ein kleines Familienhotel in Chesières, einem unspektakulären Wintersportort im Wallis, unweit von Villars. 1957 oder 1958 müssen wir dort die Winterferien verbracht haben. Das Skifahren - in meinem Fall Schlittenfahren - kann nicht sehr beeindruckend gewesen sein. Ich erinnere mich nur, dass meine Eltern und mein Onkel über den verschneiten Steg stapften und weiter hinauf zum Skilift und den Tag dort oben verbrachten, den Fleischtöpfen des Après-ski jedoch einen ruhigen Abend im Chalet vorzogen .
Das Schönste an den Winterferien war für mich immer, dass man sich draußen im Schnee tummelte, ab spätem Nachmittag saß man in tiefen Sesseln, bei Glühwein und deftiger Bauernküche, und die Abende verbrachte man entspannt im Aufenthaltsraum mit den anderen Gästen . Aber was für Gäste! Das Bemerkenswerte an diesem kleinen Hotel in Chesières war, dass dort abgerissene englische Schauspieler ihren Urlaub verbrachten, unbeeindruckt vom Schatten ihrer erfolgreicheren Kollegen weiter oben in den Bergen.
Am zweiten Abend flog ein Schwall obszöner Ausdrücke durch den Speisesaal, was meine Mutter aufschreckte . Sie war zwar unweit der alten West India Docks aufgewachsen, also durchaus vertraut mit ordinärer Sprache, aber sie war in die höfliche Vorhölle von Damenfrisiersalons aufgestiegen und hatte nicht die Absicht, derart unflätige Ausdrücke in Gegenwart ihrer Familie zu dulden .
Mrs. Judt marschierte also los und bat die Leute um Mäßigung, es seien Kinder anwesend . Da meine Schwester noch keine anderthalb Jahre alt und ich das einzige andere Kind im Hotel war, galt diese Bitte offenbar meinem Wohlergehen. Die jungen - und wie ich später vermutete: arbeitslosen - Schauspieler, die diese heftige Reaktion verursacht hatten, entschuldigten sich sofort und luden uns zum Dessert an ihren Tisch ein .
Es war eine wunderbare Truppe, besonders für den Zehnjährigen, der mit offenen Augen und Ohren in ihrer Mitte saß. Damals waren sie alle unbekannt, doch einige hatten eine glänzende Zukunft vor sich - Alan Badel etwa, noch nicht der prominente Schauspieler mit eindrucksvoller Filmographie (Der Schakal), vor allem aber die umwerfende Rachel Roberts, die in den großen englischen Nachkriegsfilmen die desillusionierte Arbeiterfrau spielen sollte (Samstagnacht bis Sonntagmorgen, Lockender Lorbeer, Der Erfolgreiche) . Roberts nahm mich unter ihre Fittiche, murmelte nicht zitierfähige Flüche mit ihrer tiefen whiskygegerbten Stimme, die mir keine Illusionen über ihre Zukunft ließ, in bezug auf meine eigene aber doch für eine gewisse Verwirrung sorgte . Sie brachte mir Pokern bei, diverse Kartenspielertricks und unvergessliche ordinäre Ausdrücke.
Vielleicht deswegen habe ich schönere, wärmere Erinnerungen an das kleine Hotel in Chesières als an andere, ähnliche Holzhäuser, in denen ich im Lauf der Jahre übernachtet habe. Wir blieben nur etwa zehn Tage, und ich bin später nur ein Mal wieder dort gewesen, für kurze Zeit. Aber noch heute kann ich das Haus sehr genau beschreiben.
Es war alles ganz unluxuriös. Man betrat das Haus über das Souterrain, wo die nassen Wintersachen (Skier, Stiefel, Stöcke, Jacken, Schlitten usw.) deponiert wurden. Darüber, zu beiden Seiten der Rezeption, befanden sich die gemütlichen, warmen, offenen Gästeräume mit großen Fenstern, durch die man auf die Hauptstraße des Dorfs hinaussah und auf die steilen Hänge ringsum. Im hinteren Teil befanden sich Küche und andere Arbeitsräume, verdeckt von einer breiten, sehr steilen Treppe, die in das Obergeschoss mit den Gästezimmern führte.
Linker Hand befanden sich die besser ausgestatteten Zimmer, rechts die kleineren Einzelzimmer ohne fließend Wasser, und ganz hinten führte eine schmale Stiege zum Dachgeschoss mit Kammern, die dem Personal vorbehalten waren (außer in der Hochsaison). Ich habe nicht nachgezählt, aber ich glaube nicht, dass es mehr als zwölf Gästezimmer gab, neben den drei Gemeinschaftsräumen. Es war ein einfaches Hotel für kleine Familien mit bescheidenen Mitteln, in einem unspektakulären Dorf, das über seine geographische Lage hinaus keine großen Ambitionen hatte. Es muss zehntausend solcher Hotels in der Schweiz geben, von einem habe ich zufällig ein nahezu vollkommenes Bild.
Ich glaube nicht, dass ich in den anschließenden fünfzig Jahren oft an das Chalet in Chesières gedacht habe. Doch als bei mir vor zwei Jahren Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde und bald klar war, dass ich vermutlich nie mehr würde reisen können - ich konnte froh sein, wenn ich überhaupt imstande wäre, über meine Reisen zu schreiben -, kam mir immer wieder ebenjenes Chalet in den Sinn . Warum?
Das Besondere an dieser neurodegenerativen Erkrankung ist, dass man bei klarem Verstand über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachdenken, diese Reflexionen aber immer weniger in Worte fassen kann. Zuerst kann man nicht mehr schreiben. Um die Gedanken festzuhalten, benötigt man einen Assistenten oder eine Maschine. Dann versagen einem die Beine den Dienst, man kann keine neuen Erfahrungen mehr machen, es sei denn mit einem derart komplexen logistischen Aufwand, dass es nur noch um Mobilität an sich geht und nicht mehr um das, was sie ermöglicht .
Als nächstes verliert man die Stimme. Nicht nur in dem übertragenen Sinne, dass man mit Hilfe von Maschinen oder menschlichen Vermittlern sprechen muss, sondern buchstäblich - die Zwerchfellmuskeln können keine Luft mehr in Richtung Stimmbänder pumpen, weshalb man keine verständlichen Töne mehr hervorbringen kann. An diesem Punkt ist man meist komplett gelähmt, verdammt zu stummer Unbeweglichkeit, selbst im Beisein anderer.
Für jemanden, der immer schon gern Worte und Ideen kommuniziert hat, ist das eine ungewöhnliche Herausforderung. Dahin ist das Notizheft und der nunmehr nutzlose Stift, der erholsame Spaziergang im Park und die Stunde im Sportstudio, in der Überlegungen und Argumente wie durch natürliche Auslese zurechtgerückt werden. Dahin auch die produktiven Gespräche mit Freunden - selbst im mittleren Stadium von ALS denkt man schneller, als man Worte bilden kann, so dass Gespräche stockend verlaufen, frustrieren und letztlich sinnlos werden.
Auf die Lösung für dieses Dilemma bin ich durch Zufall gestoßen. Ein paar Monate nach Ausbruch der Krankheit fiel mir auf, dass ich nachts in meinem Kopf ganze Geschichten schrieb. Bestimmt suchte ich Ablenkung - an die Stelle des Schäfchenzählens traten komplexe Erzählungen von vergleichbarer Wirkung. Im Laufe dieser kleinen Übungen erkannte ich, dass ich Segmente meiner Vergangenheit wie Lego-Steine zusammenfügte, von denen mir bislang nicht klar gewesen war, dass sie zusammengehörten. Das war nichts Besonderes. Die Bewusstseinsströme, die mich von einer Dampfmaschine zum Deutschunterricht führten - von den sorgfältig rekonstruierten Strecken der Londoner Regionalbusse bis zur Geschichte der Stadtplanung in der Zwischenkriegszeit -, waren leicht zu verfolgen, in viele interessante Richtungen Aber wie konnte ich diese halbverborgenen Pfade am nächsten Tag wieder präsent haben?
In dieser Situation begannen die nostalgischen Erinnerungen an glücklichere Tage in verschlafenen mitteleuropäischen Dörfern eine ganz praktische Rolle zu spielen. Schon immer hatten mich die Gedächtnistechniken neuzeitlicher Philosophen und Reisender fasziniert, mit deren Hilfe sie detaillierte Beschreibungen speicherten, um sie später abrufen zu können. Frances Yates hat diese Techniken ebenso anschaulich geschildert wie zuletzt Jonathan Spence in The Memory Palace of Matteo Ricci, der Geschichte eines italienischen China-Reisenden.
Diese Gedächtniskünstler bauten nicht bloß Gasthäuser oder Herbergen, in denen sie ihr Wissen einquartierten, sondern richtige Schlösser. Ich hatte aber keine Lust, in meinem Kopf einen Palast zu konstruieren. Die Originale waren mir immer etwas überladen erschienen - ob Hampton Court oder Versailles, diese Pracht sollte eher beeindrucken als dienen. In meinen stillen und stummen Nächten konnte ich mir einen solchen Gedächtnispalast ebenso wenig vorstellen, wie ich mir ein sternenbesticktes Kostüm aus Hose und Weste hätte nähen können. Aber wenn schon kein Palast, dann vielleicht ein Chalet der Erinnerungen.
Der Vorteil eines Chalets lag nicht nur darin, dass ich es mir sehr detailliert vorstellen konnte - vom Treppengeländer bis zu den Fenstern, die vor dem eisigen Wind schützten -, es war auch ein Ort, den ich immer wieder gern aufsuchen würde . Ein Gedächtnisort kann nur dann als Speicher unendlich vieler Erinnerungen funktionieren, wenn er von besonderem Reiz ist, und sei es nur für einen einzigen Menschen. Über Tage, Wochen, Monate und mittlerweile reichlich ein Jahr bin ich, Nacht für Nacht, immer wieder in dieses Chalet zurückgekehrt. Ich bin die vertrauten Korridore entlanggegangen, die ausgetretenen Steinstufen hinauf, und habe mich in einen der zwei oder drei Sessel gesetzt, der praktischerweise gerade frei war. Und dann habe ich mir eine halbwegs plausible Geschichte ausgedacht, ein Argument zurechtgelegt oder ein Beispiel entwickelt, das ich am nächsten Tag niederschreiben würde.
Und dann? In diesem Moment verwandelt sich das Chalet von einem Auslöser von Erinnerungen in einen Speicher. Sobald ich ungefähr weiß, was ich sagen will und in welchem Zusammenhang, erhebe ich mich aus dem Sessel und gehe wieder zur Eingangstür des Chalets. Von dort rekonstruiere ich meine Schritte, von dem ersten Abstellschrank (etwa für Skier) in immer gediegenere Räume: zur Bar, in den Speisesaal, den Aufenthaltsraum, zur Rezeption mit dem altmodischen Schlüsselbrett unter der Kuckucksuhr, zum Büchersammelsurium an der hinteren Treppe und von dort hinauf zu einem der Gästezimmer. Jeder einzelne Ort erhält eine bestimmte Funktion etwa in einer Geschichte oder dient vielleicht als anschauliches Beispiel.
Das System ist alles andere als perfekt. Da es immer wieder zu Überschneidungen kommt, muss ich darauf achten, dass jede neue Geschichte eine andere Landkarte hat, damit sie nicht mit einer älteren, ähnlichen Geschichte verwechselt werden kann. So ist es, entgegen dem ersten Anschein, nicht klug, das ganze Thema Ernährung in einen Raum zu packen, das Thema Verführung oder Sex in einen zweiten, intellektuelle Themen in einen dritten. Man verlässt sich besser auf die Mikrogeographie (diese Kommode steht neben dem Schrank an jener Wand) als auf die Logik der uns prägenden konventionellen mentalen Einrichtung.
Ich bin überrascht, wie schwer es den meisten Leuten fällt, ihre Gedanken räumlich zu ordnen, um sie ein paar Stunden später wieder abrufen zu können. Für mich - zugegeben: dank der ungewöhnlichen Zwänge meines körperlichen Gefangenseins - ist diese Methode sehr leicht, fast allzu mechanisch. Sie gibt mir die Möglichkeit, Beispiele und Sequenzen und Paradoxa in einer Weise zu arrangieren, die das ursprüngliche und viel anregendere Durcheinander von Eindrücken und Erinnerungen täuschend ordentlich erscheinen lässt.
Ich frage mich, ob Männer es vielleicht leichter haben, ich meine den üblichen Typus, der besser einparkt und ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen hat als die durchschnittliche Frau, die überall dort besser abschneidet, wo es auf Personengedächtnis und Einfühlungsvermögen ankommt. Als Kind konnte ich damit punkten, dass ich einen Autofahrer nur anhand einer Karte durch eine völlig fremde Stadt zu lotsen imstande war. Passen musste und muss ich dagegen bei der Grundanforderung an ambitionierte Politiker - der Fähigkeit, eine Dinnerparty zu geben, die häuslichen Verhältnisse und politischen Einstellungen sämtlicher Gäste im Kopf zu haben und schließlich an der Tür jeden Einzelnen mit Vornamen zu verabschieden . Es muss auch dafür eine Gedächtnistechnik geben, ich habe sie aber nie gefunden.
Seit Ausbruch meiner Krankheit habe ich ein schmales politisches Buch fertiggestellt, einen Vortrag gehalten, rund zwanzig autobiographische Skizzen verfasst und eine Reihe von Gesprächen geführt, in denen es darum ging, noch einmal einen Blick auf die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zu werfen . All diese Unternehmungen stützten sich auf wenig mehr als nächtliche Besuche in meinem Chalet der Erinnerungen und den anschließenden Versuch, den Inhalt dieser Besuche möglichst detailgetreu wiederzugeben. Der Blick ist manchmal nach innen gerichtet - ausgehend von einem Haus, einem Bus oder einem Mann -, dann wieder nach außen, auf ein Leben als politisch engagierter Beobachter, Lehrer und Kommentator.
Gewiss, es gab Nächte, in denen ich (einigermaßen komfortabel) Rachel Roberts gegenübersaß oder nur Leere vor mir hatte: Menschen und Orte kamen nur, um sofort wieder zu verschwinden. In derart unproduktiven Momenten bleibe ich nicht lange. Ich gehe wieder zu der alten Tür, trete hinaus und wandere - die Geographie beugt sich kindlicher Assoziation - durch das Berner Oberland und sitze ein wenig mürrisch auf einer Bank. Rachel Roberts' gebannter kleiner Zuhörer hat sich in Heidis verschlossenen Almöhi verwandelt. Hier verbringe ich die Stunden in unruhigem Halbschlaf, bevor ich aufwache, ein wenig verärgert, weil es mir nicht gelungen ist, trotz aller nächtlichen Anstrengungen irgendetwas zu schaffen, zu speichern und mir wieder in Erinnerung zu rufen.
Unproduktive Nächte sind geradezu körperlich frustrierend. Zwar kann man sich sagen, na, komm schon, freu dich lieber, dass du nicht den Verstand verloren hast - wo steht denn geschrieben, dass du außerdem noch produktiv sein sollst? Und doch mache ich mir Vorwürfe, so bereitwillig vor dem Schicksal kapituliert zu haben. Wer könnte sich in dieser Situation besser verhalten? Die Antwort lautet natürlich: Ein besseres Ich. Es ist schon erstaunlich, wie oft wir besser sein wollen als unser Ich - obwohl wir wissen, wie schwer es war, bis dahin zu kommen.
Ich habe nichts gegen diesen Streich, den uns das Gewissen spielt. Aber es macht die Nacht anfällig für die nicht zu unterschätzenden Gefahren unserer dunklen Seite. Der mürrisch dreinblickende Almöhi ist kein glücklicher Mensch. Seine Düsternis wird nur gelegentlich vertrieben, wenn er nachts Schränke und Kommoden, Regale und Korridore mit den Nebenprodukten wiederaufgerufener Erinnerung füllt.
Der Almöhi, mein ewig unzufriedenes Alter ego, sitzt aber nicht einfach frustriert vor der Tür des Chalets. Er hockt da und raucht eine Gitane, hält ein Glas Whisky in der Hand, studiert die Zeitung, stapft ziellos durch die verschneiten Straßen, pfeift wehmütig vor sich hin - und verhält sich im allgemeinen wie ein freier Mensch . In manchen Nächten gelingt ihm nur das. Verbitterte Erinnerung an all das Verlorene? Oder nur der Trost der erinnerten Zigarette?
Doch in anderen Nächten gehe ich einfach an ihm vorüber. Alles funktioniert. Die Gesichter sind wieder da, die Beispiele sind gut, die sepiabraunen Fotos werden lebendig, alles passt zusammen, und rasch habe ich meine Geschichte mitsamt Figuren, Illustrationen und Moral. Der Almöhi und seine missmutigen Erinnerungen an die verlorene Welt zählen nicht: Die Vergangenheit umgibt mich, ich habe, was ich brauche.
Aber welche Vergangenheit? Die kleinen Geschichten, die in nächtlicher Düsternis Gestalt annehmen, sind anders als alles, was ich bislang geschrieben habe. Selbst gemessen an den strengen Anforderungen meines Berufs war ich immer ein rational argumentierender Verstandesmensch. Von all den Berufsklischees hat mir besonders gut die Behauptung gefallen, Historiker seien nur Philosophen, die anhand von Beispielen unterrichten. Das scheint mir noch immer gültig zu sein, auch wenn ich das inzwischen auf indirektere Weise tue.
Früher hätte ich mich vielleicht als einen schreibenden Geppetto gesehen, der aus Thesen und Beweisen kleine Pinocchios erschafft, die dank der Plausibilität ihrer logischen Konstruktion lebendig werden und die die Wahrheit sagen, weil ihre Einzelteile eben so beschaffen sind . Meine jüngsten Arbeiten sind weitaus induktiver. Ihre Qualität beruht auf einer impressionistischen Wirkung - dem Versuch, das Private und das Politische, Verstand und Intuition, Erinnerung und Gefühl miteinander zu verknüpfen.
Ich weiß nicht, welches Genre das ist. Die entstandenen kleinen Holzfiguren scheinen mir ungezwungener und zugleich menschlicher als ihre deduktiv konstruierten, nach strengen Mustern entworfenen Ahnen. In polemischer Form - »Austerity« etwa - erinnern sie mich an die längst vergessenen Wien-Feuilletons von Karl Kraus - anspielungsreich, anregend, fast zu leicht für ihren Gehalt Andere - emotionaler im Ton, »Essen« vielleicht oder »Putney« - dienen dem entgegengesetzten Zweck . Indem sie die gewichtigen Abstraktionen vermeiden, die wir von »Identitätssuchern« kennen, gelingt es ihnen vielleicht, ohne große Worte ebenjene verborgenen Konturen aufzudecken.
Wenn ich diese Feuilletons noch einmal lese, sehe ich den Mann, der ich nicht geworden bin. Vor Jahrzehnten wurde mir geraten, Literatur zu studieren. Geschichte, erklärte mir ein kluger Lehrer, käme mir allzu sehr entgegen, würde mich jeder Anstrengung entheben. Literatur jedoch, vor allem Dichtung, würde mich zwingen, nach ungewohnten Worten und Ausdrucksweisen zu suchen, zu denen ich vielleicht sogar eine gewisse Affinität entwickeln könnte. Ich kann nicht sagen, dass ich es bedauere, diesem Rat nicht gefolgt zu sein. Meine klassisch intellektuellen Denkgewohnheiten haben mir gute Dienste geleistet. Aber etwas ist dabei wohl auf der Strecke geblieben.
Als Kind habe ich mehr beobachtet, als ich verstanden habe. Vielleicht ist das bei jedem Kind so. Mein Fall wäre dann nur insofern anders, als diese schreckliche Krankheit mir die Gelegenheit gibt, meine Beobachtungen noch einmal systematisch zu betrachten. Aber wie war es wirklich? Wenn mich jemand fragt: »Wie kannst du dich an den Geruch der grünen Busse erinnern?« oder »Warum haben sich dir bestimmte Details französischer Landhotels so stark eingeprägt?«, dann heißt das, dass schon damals kleine Chalets der Erinnerung gebaut wurden .
Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich habe die Kindheit einfach erlebt, habe sie vielleicht mit anderen Bestandteilen ihrer selbst verknüpft als andere Kinder, aber bestimmt habe ich sie nicht zwecks späterer Verwendung absichtsvoll in meinem Gedächtnis eingelagert . Ich war Einzelkind und habe meine Gedanken für mich behalten. Daran ist nichts Besonderes. Wenn die Erinnerung in den letzten Monaten so mühelos zurückgekehrt ist, dann vermutlich aus einem anderen Grund.
Der Vorteil meines Berufs ist, dass man Erzählungen hat, in die man Beispiele, Details, Illustrationen einfügen kann. Als Historiker der Nachkriegswelt, der sich in stummer Selbstbefragung an Einzelheiten aus dem eigenen Leben erinnert, habe ich den Vorzug eines Narrativs, das losgelöste Erinnerungen zusammenfügt und lebendig macht . Was mich von vielen anderen unterscheidet, die (wie ich meiner jüngsten Korrespondenz entnehmen kann) vergleichbare Erinnerungen haben, ist, dass ich sie in vielerlei Weise verwenden kann. Das allein ist ein großes Glück.
Man mag es geschmacklos finden, wenn ein gesunder Mann mit junger Familie, der mit sechzig von einer unheilbaren Nervenkrankheit erwischt wird, an der er bald sterben muss, von Glück spricht. Doch es gibt verschiedene Sorten Glück. Opfer einer Motoneuronkrankheit zu werden bedeutet sicher, irgendwann die Götter beleidigt zu haben, und dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Wenn man aber in dieser Weise leiden muss, ist es besser, einen gutausgestatteten Kopf zu haben - voller abrufbarer, vielseitig verwendbarer Erinnerungen, die einem analytischen Verstand jederzeit zur Verfügung stehen . Es fehlte nur ein Speicher. Dass es mir vergönnt war, in dem Fangnetz eines Lebens auch dies zu finden, empfinde ich als ziemlichen Glücksfall. Ich hoffe, ich habe etwas Sinnvolles damit angefangen.
Tony Judt
New York, Mai 2010
Copyright © S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Das Wort »Chalet« löst ein ganz bestimmtes Bild in mir aus Ich sehe ein kleines Familienhotel in Chesières, einem unspektakulären Wintersportort im Wallis, unweit von Villars. 1957 oder 1958 müssen wir dort die Winterferien verbracht haben. Das Skifahren - in meinem Fall Schlittenfahren - kann nicht sehr beeindruckend gewesen sein. Ich erinnere mich nur, dass meine Eltern und mein Onkel über den verschneiten Steg stapften und weiter hinauf zum Skilift und den Tag dort oben verbrachten, den Fleischtöpfen des Après-ski jedoch einen ruhigen Abend im Chalet vorzogen .
Das Schönste an den Winterferien war für mich immer, dass man sich draußen im Schnee tummelte, ab spätem Nachmittag saß man in tiefen Sesseln, bei Glühwein und deftiger Bauernküche, und die Abende verbrachte man entspannt im Aufenthaltsraum mit den anderen Gästen . Aber was für Gäste! Das Bemerkenswerte an diesem kleinen Hotel in Chesières war, dass dort abgerissene englische Schauspieler ihren Urlaub verbrachten, unbeeindruckt vom Schatten ihrer erfolgreicheren Kollegen weiter oben in den Bergen.
Am zweiten Abend flog ein Schwall obszöner Ausdrücke durch den Speisesaal, was meine Mutter aufschreckte . Sie war zwar unweit der alten West India Docks aufgewachsen, also durchaus vertraut mit ordinärer Sprache, aber sie war in die höfliche Vorhölle von Damenfrisiersalons aufgestiegen und hatte nicht die Absicht, derart unflätige Ausdrücke in Gegenwart ihrer Familie zu dulden .
Mrs. Judt marschierte also los und bat die Leute um Mäßigung, es seien Kinder anwesend . Da meine Schwester noch keine anderthalb Jahre alt und ich das einzige andere Kind im Hotel war, galt diese Bitte offenbar meinem Wohlergehen. Die jungen - und wie ich später vermutete: arbeitslosen - Schauspieler, die diese heftige Reaktion verursacht hatten, entschuldigten sich sofort und luden uns zum Dessert an ihren Tisch ein .
Es war eine wunderbare Truppe, besonders für den Zehnjährigen, der mit offenen Augen und Ohren in ihrer Mitte saß. Damals waren sie alle unbekannt, doch einige hatten eine glänzende Zukunft vor sich - Alan Badel etwa, noch nicht der prominente Schauspieler mit eindrucksvoller Filmographie (Der Schakal), vor allem aber die umwerfende Rachel Roberts, die in den großen englischen Nachkriegsfilmen die desillusionierte Arbeiterfrau spielen sollte (Samstagnacht bis Sonntagmorgen, Lockender Lorbeer, Der Erfolgreiche) . Roberts nahm mich unter ihre Fittiche, murmelte nicht zitierfähige Flüche mit ihrer tiefen whiskygegerbten Stimme, die mir keine Illusionen über ihre Zukunft ließ, in bezug auf meine eigene aber doch für eine gewisse Verwirrung sorgte . Sie brachte mir Pokern bei, diverse Kartenspielertricks und unvergessliche ordinäre Ausdrücke.
Vielleicht deswegen habe ich schönere, wärmere Erinnerungen an das kleine Hotel in Chesières als an andere, ähnliche Holzhäuser, in denen ich im Lauf der Jahre übernachtet habe. Wir blieben nur etwa zehn Tage, und ich bin später nur ein Mal wieder dort gewesen, für kurze Zeit. Aber noch heute kann ich das Haus sehr genau beschreiben.
Es war alles ganz unluxuriös. Man betrat das Haus über das Souterrain, wo die nassen Wintersachen (Skier, Stiefel, Stöcke, Jacken, Schlitten usw.) deponiert wurden. Darüber, zu beiden Seiten der Rezeption, befanden sich die gemütlichen, warmen, offenen Gästeräume mit großen Fenstern, durch die man auf die Hauptstraße des Dorfs hinaussah und auf die steilen Hänge ringsum. Im hinteren Teil befanden sich Küche und andere Arbeitsräume, verdeckt von einer breiten, sehr steilen Treppe, die in das Obergeschoss mit den Gästezimmern führte.
Linker Hand befanden sich die besser ausgestatteten Zimmer, rechts die kleineren Einzelzimmer ohne fließend Wasser, und ganz hinten führte eine schmale Stiege zum Dachgeschoss mit Kammern, die dem Personal vorbehalten waren (außer in der Hochsaison). Ich habe nicht nachgezählt, aber ich glaube nicht, dass es mehr als zwölf Gästezimmer gab, neben den drei Gemeinschaftsräumen. Es war ein einfaches Hotel für kleine Familien mit bescheidenen Mitteln, in einem unspektakulären Dorf, das über seine geographische Lage hinaus keine großen Ambitionen hatte. Es muss zehntausend solcher Hotels in der Schweiz geben, von einem habe ich zufällig ein nahezu vollkommenes Bild.
Ich glaube nicht, dass ich in den anschließenden fünfzig Jahren oft an das Chalet in Chesières gedacht habe. Doch als bei mir vor zwei Jahren Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde und bald klar war, dass ich vermutlich nie mehr würde reisen können - ich konnte froh sein, wenn ich überhaupt imstande wäre, über meine Reisen zu schreiben -, kam mir immer wieder ebenjenes Chalet in den Sinn . Warum?
Das Besondere an dieser neurodegenerativen Erkrankung ist, dass man bei klarem Verstand über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachdenken, diese Reflexionen aber immer weniger in Worte fassen kann. Zuerst kann man nicht mehr schreiben. Um die Gedanken festzuhalten, benötigt man einen Assistenten oder eine Maschine. Dann versagen einem die Beine den Dienst, man kann keine neuen Erfahrungen mehr machen, es sei denn mit einem derart komplexen logistischen Aufwand, dass es nur noch um Mobilität an sich geht und nicht mehr um das, was sie ermöglicht .
Als nächstes verliert man die Stimme. Nicht nur in dem übertragenen Sinne, dass man mit Hilfe von Maschinen oder menschlichen Vermittlern sprechen muss, sondern buchstäblich - die Zwerchfellmuskeln können keine Luft mehr in Richtung Stimmbänder pumpen, weshalb man keine verständlichen Töne mehr hervorbringen kann. An diesem Punkt ist man meist komplett gelähmt, verdammt zu stummer Unbeweglichkeit, selbst im Beisein anderer.
Für jemanden, der immer schon gern Worte und Ideen kommuniziert hat, ist das eine ungewöhnliche Herausforderung. Dahin ist das Notizheft und der nunmehr nutzlose Stift, der erholsame Spaziergang im Park und die Stunde im Sportstudio, in der Überlegungen und Argumente wie durch natürliche Auslese zurechtgerückt werden. Dahin auch die produktiven Gespräche mit Freunden - selbst im mittleren Stadium von ALS denkt man schneller, als man Worte bilden kann, so dass Gespräche stockend verlaufen, frustrieren und letztlich sinnlos werden.
Auf die Lösung für dieses Dilemma bin ich durch Zufall gestoßen. Ein paar Monate nach Ausbruch der Krankheit fiel mir auf, dass ich nachts in meinem Kopf ganze Geschichten schrieb. Bestimmt suchte ich Ablenkung - an die Stelle des Schäfchenzählens traten komplexe Erzählungen von vergleichbarer Wirkung. Im Laufe dieser kleinen Übungen erkannte ich, dass ich Segmente meiner Vergangenheit wie Lego-Steine zusammenfügte, von denen mir bislang nicht klar gewesen war, dass sie zusammengehörten. Das war nichts Besonderes. Die Bewusstseinsströme, die mich von einer Dampfmaschine zum Deutschunterricht führten - von den sorgfältig rekonstruierten Strecken der Londoner Regionalbusse bis zur Geschichte der Stadtplanung in der Zwischenkriegszeit -, waren leicht zu verfolgen, in viele interessante Richtungen Aber wie konnte ich diese halbverborgenen Pfade am nächsten Tag wieder präsent haben?
In dieser Situation begannen die nostalgischen Erinnerungen an glücklichere Tage in verschlafenen mitteleuropäischen Dörfern eine ganz praktische Rolle zu spielen. Schon immer hatten mich die Gedächtnistechniken neuzeitlicher Philosophen und Reisender fasziniert, mit deren Hilfe sie detaillierte Beschreibungen speicherten, um sie später abrufen zu können. Frances Yates hat diese Techniken ebenso anschaulich geschildert wie zuletzt Jonathan Spence in The Memory Palace of Matteo Ricci, der Geschichte eines italienischen China-Reisenden.
Diese Gedächtniskünstler bauten nicht bloß Gasthäuser oder Herbergen, in denen sie ihr Wissen einquartierten, sondern richtige Schlösser. Ich hatte aber keine Lust, in meinem Kopf einen Palast zu konstruieren. Die Originale waren mir immer etwas überladen erschienen - ob Hampton Court oder Versailles, diese Pracht sollte eher beeindrucken als dienen. In meinen stillen und stummen Nächten konnte ich mir einen solchen Gedächtnispalast ebenso wenig vorstellen, wie ich mir ein sternenbesticktes Kostüm aus Hose und Weste hätte nähen können. Aber wenn schon kein Palast, dann vielleicht ein Chalet der Erinnerungen.
Der Vorteil eines Chalets lag nicht nur darin, dass ich es mir sehr detailliert vorstellen konnte - vom Treppengeländer bis zu den Fenstern, die vor dem eisigen Wind schützten -, es war auch ein Ort, den ich immer wieder gern aufsuchen würde . Ein Gedächtnisort kann nur dann als Speicher unendlich vieler Erinnerungen funktionieren, wenn er von besonderem Reiz ist, und sei es nur für einen einzigen Menschen. Über Tage, Wochen, Monate und mittlerweile reichlich ein Jahr bin ich, Nacht für Nacht, immer wieder in dieses Chalet zurückgekehrt. Ich bin die vertrauten Korridore entlanggegangen, die ausgetretenen Steinstufen hinauf, und habe mich in einen der zwei oder drei Sessel gesetzt, der praktischerweise gerade frei war. Und dann habe ich mir eine halbwegs plausible Geschichte ausgedacht, ein Argument zurechtgelegt oder ein Beispiel entwickelt, das ich am nächsten Tag niederschreiben würde.
Und dann? In diesem Moment verwandelt sich das Chalet von einem Auslöser von Erinnerungen in einen Speicher. Sobald ich ungefähr weiß, was ich sagen will und in welchem Zusammenhang, erhebe ich mich aus dem Sessel und gehe wieder zur Eingangstür des Chalets. Von dort rekonstruiere ich meine Schritte, von dem ersten Abstellschrank (etwa für Skier) in immer gediegenere Räume: zur Bar, in den Speisesaal, den Aufenthaltsraum, zur Rezeption mit dem altmodischen Schlüsselbrett unter der Kuckucksuhr, zum Büchersammelsurium an der hinteren Treppe und von dort hinauf zu einem der Gästezimmer. Jeder einzelne Ort erhält eine bestimmte Funktion etwa in einer Geschichte oder dient vielleicht als anschauliches Beispiel.
Das System ist alles andere als perfekt. Da es immer wieder zu Überschneidungen kommt, muss ich darauf achten, dass jede neue Geschichte eine andere Landkarte hat, damit sie nicht mit einer älteren, ähnlichen Geschichte verwechselt werden kann. So ist es, entgegen dem ersten Anschein, nicht klug, das ganze Thema Ernährung in einen Raum zu packen, das Thema Verführung oder Sex in einen zweiten, intellektuelle Themen in einen dritten. Man verlässt sich besser auf die Mikrogeographie (diese Kommode steht neben dem Schrank an jener Wand) als auf die Logik der uns prägenden konventionellen mentalen Einrichtung.
Ich bin überrascht, wie schwer es den meisten Leuten fällt, ihre Gedanken räumlich zu ordnen, um sie ein paar Stunden später wieder abrufen zu können. Für mich - zugegeben: dank der ungewöhnlichen Zwänge meines körperlichen Gefangenseins - ist diese Methode sehr leicht, fast allzu mechanisch. Sie gibt mir die Möglichkeit, Beispiele und Sequenzen und Paradoxa in einer Weise zu arrangieren, die das ursprüngliche und viel anregendere Durcheinander von Eindrücken und Erinnerungen täuschend ordentlich erscheinen lässt.
Ich frage mich, ob Männer es vielleicht leichter haben, ich meine den üblichen Typus, der besser einparkt und ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen hat als die durchschnittliche Frau, die überall dort besser abschneidet, wo es auf Personengedächtnis und Einfühlungsvermögen ankommt. Als Kind konnte ich damit punkten, dass ich einen Autofahrer nur anhand einer Karte durch eine völlig fremde Stadt zu lotsen imstande war. Passen musste und muss ich dagegen bei der Grundanforderung an ambitionierte Politiker - der Fähigkeit, eine Dinnerparty zu geben, die häuslichen Verhältnisse und politischen Einstellungen sämtlicher Gäste im Kopf zu haben und schließlich an der Tür jeden Einzelnen mit Vornamen zu verabschieden . Es muss auch dafür eine Gedächtnistechnik geben, ich habe sie aber nie gefunden.
Seit Ausbruch meiner Krankheit habe ich ein schmales politisches Buch fertiggestellt, einen Vortrag gehalten, rund zwanzig autobiographische Skizzen verfasst und eine Reihe von Gesprächen geführt, in denen es darum ging, noch einmal einen Blick auf die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zu werfen . All diese Unternehmungen stützten sich auf wenig mehr als nächtliche Besuche in meinem Chalet der Erinnerungen und den anschließenden Versuch, den Inhalt dieser Besuche möglichst detailgetreu wiederzugeben. Der Blick ist manchmal nach innen gerichtet - ausgehend von einem Haus, einem Bus oder einem Mann -, dann wieder nach außen, auf ein Leben als politisch engagierter Beobachter, Lehrer und Kommentator.
Gewiss, es gab Nächte, in denen ich (einigermaßen komfortabel) Rachel Roberts gegenübersaß oder nur Leere vor mir hatte: Menschen und Orte kamen nur, um sofort wieder zu verschwinden. In derart unproduktiven Momenten bleibe ich nicht lange. Ich gehe wieder zu der alten Tür, trete hinaus und wandere - die Geographie beugt sich kindlicher Assoziation - durch das Berner Oberland und sitze ein wenig mürrisch auf einer Bank. Rachel Roberts' gebannter kleiner Zuhörer hat sich in Heidis verschlossenen Almöhi verwandelt. Hier verbringe ich die Stunden in unruhigem Halbschlaf, bevor ich aufwache, ein wenig verärgert, weil es mir nicht gelungen ist, trotz aller nächtlichen Anstrengungen irgendetwas zu schaffen, zu speichern und mir wieder in Erinnerung zu rufen.
Unproduktive Nächte sind geradezu körperlich frustrierend. Zwar kann man sich sagen, na, komm schon, freu dich lieber, dass du nicht den Verstand verloren hast - wo steht denn geschrieben, dass du außerdem noch produktiv sein sollst? Und doch mache ich mir Vorwürfe, so bereitwillig vor dem Schicksal kapituliert zu haben. Wer könnte sich in dieser Situation besser verhalten? Die Antwort lautet natürlich: Ein besseres Ich. Es ist schon erstaunlich, wie oft wir besser sein wollen als unser Ich - obwohl wir wissen, wie schwer es war, bis dahin zu kommen.
Ich habe nichts gegen diesen Streich, den uns das Gewissen spielt. Aber es macht die Nacht anfällig für die nicht zu unterschätzenden Gefahren unserer dunklen Seite. Der mürrisch dreinblickende Almöhi ist kein glücklicher Mensch. Seine Düsternis wird nur gelegentlich vertrieben, wenn er nachts Schränke und Kommoden, Regale und Korridore mit den Nebenprodukten wiederaufgerufener Erinnerung füllt.
Der Almöhi, mein ewig unzufriedenes Alter ego, sitzt aber nicht einfach frustriert vor der Tür des Chalets. Er hockt da und raucht eine Gitane, hält ein Glas Whisky in der Hand, studiert die Zeitung, stapft ziellos durch die verschneiten Straßen, pfeift wehmütig vor sich hin - und verhält sich im allgemeinen wie ein freier Mensch . In manchen Nächten gelingt ihm nur das. Verbitterte Erinnerung an all das Verlorene? Oder nur der Trost der erinnerten Zigarette?
Doch in anderen Nächten gehe ich einfach an ihm vorüber. Alles funktioniert. Die Gesichter sind wieder da, die Beispiele sind gut, die sepiabraunen Fotos werden lebendig, alles passt zusammen, und rasch habe ich meine Geschichte mitsamt Figuren, Illustrationen und Moral. Der Almöhi und seine missmutigen Erinnerungen an die verlorene Welt zählen nicht: Die Vergangenheit umgibt mich, ich habe, was ich brauche.
Aber welche Vergangenheit? Die kleinen Geschichten, die in nächtlicher Düsternis Gestalt annehmen, sind anders als alles, was ich bislang geschrieben habe. Selbst gemessen an den strengen Anforderungen meines Berufs war ich immer ein rational argumentierender Verstandesmensch. Von all den Berufsklischees hat mir besonders gut die Behauptung gefallen, Historiker seien nur Philosophen, die anhand von Beispielen unterrichten. Das scheint mir noch immer gültig zu sein, auch wenn ich das inzwischen auf indirektere Weise tue.
Früher hätte ich mich vielleicht als einen schreibenden Geppetto gesehen, der aus Thesen und Beweisen kleine Pinocchios erschafft, die dank der Plausibilität ihrer logischen Konstruktion lebendig werden und die die Wahrheit sagen, weil ihre Einzelteile eben so beschaffen sind . Meine jüngsten Arbeiten sind weitaus induktiver. Ihre Qualität beruht auf einer impressionistischen Wirkung - dem Versuch, das Private und das Politische, Verstand und Intuition, Erinnerung und Gefühl miteinander zu verknüpfen.
Ich weiß nicht, welches Genre das ist. Die entstandenen kleinen Holzfiguren scheinen mir ungezwungener und zugleich menschlicher als ihre deduktiv konstruierten, nach strengen Mustern entworfenen Ahnen. In polemischer Form - »Austerity« etwa - erinnern sie mich an die längst vergessenen Wien-Feuilletons von Karl Kraus - anspielungsreich, anregend, fast zu leicht für ihren Gehalt Andere - emotionaler im Ton, »Essen« vielleicht oder »Putney« - dienen dem entgegengesetzten Zweck . Indem sie die gewichtigen Abstraktionen vermeiden, die wir von »Identitätssuchern« kennen, gelingt es ihnen vielleicht, ohne große Worte ebenjene verborgenen Konturen aufzudecken.
Wenn ich diese Feuilletons noch einmal lese, sehe ich den Mann, der ich nicht geworden bin. Vor Jahrzehnten wurde mir geraten, Literatur zu studieren. Geschichte, erklärte mir ein kluger Lehrer, käme mir allzu sehr entgegen, würde mich jeder Anstrengung entheben. Literatur jedoch, vor allem Dichtung, würde mich zwingen, nach ungewohnten Worten und Ausdrucksweisen zu suchen, zu denen ich vielleicht sogar eine gewisse Affinität entwickeln könnte. Ich kann nicht sagen, dass ich es bedauere, diesem Rat nicht gefolgt zu sein. Meine klassisch intellektuellen Denkgewohnheiten haben mir gute Dienste geleistet. Aber etwas ist dabei wohl auf der Strecke geblieben.
Als Kind habe ich mehr beobachtet, als ich verstanden habe. Vielleicht ist das bei jedem Kind so. Mein Fall wäre dann nur insofern anders, als diese schreckliche Krankheit mir die Gelegenheit gibt, meine Beobachtungen noch einmal systematisch zu betrachten. Aber wie war es wirklich? Wenn mich jemand fragt: »Wie kannst du dich an den Geruch der grünen Busse erinnern?« oder »Warum haben sich dir bestimmte Details französischer Landhotels so stark eingeprägt?«, dann heißt das, dass schon damals kleine Chalets der Erinnerung gebaut wurden .
Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich habe die Kindheit einfach erlebt, habe sie vielleicht mit anderen Bestandteilen ihrer selbst verknüpft als andere Kinder, aber bestimmt habe ich sie nicht zwecks späterer Verwendung absichtsvoll in meinem Gedächtnis eingelagert . Ich war Einzelkind und habe meine Gedanken für mich behalten. Daran ist nichts Besonderes. Wenn die Erinnerung in den letzten Monaten so mühelos zurückgekehrt ist, dann vermutlich aus einem anderen Grund.
Der Vorteil meines Berufs ist, dass man Erzählungen hat, in die man Beispiele, Details, Illustrationen einfügen kann. Als Historiker der Nachkriegswelt, der sich in stummer Selbstbefragung an Einzelheiten aus dem eigenen Leben erinnert, habe ich den Vorzug eines Narrativs, das losgelöste Erinnerungen zusammenfügt und lebendig macht . Was mich von vielen anderen unterscheidet, die (wie ich meiner jüngsten Korrespondenz entnehmen kann) vergleichbare Erinnerungen haben, ist, dass ich sie in vielerlei Weise verwenden kann. Das allein ist ein großes Glück.
Man mag es geschmacklos finden, wenn ein gesunder Mann mit junger Familie, der mit sechzig von einer unheilbaren Nervenkrankheit erwischt wird, an der er bald sterben muss, von Glück spricht. Doch es gibt verschiedene Sorten Glück. Opfer einer Motoneuronkrankheit zu werden bedeutet sicher, irgendwann die Götter beleidigt zu haben, und dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Wenn man aber in dieser Weise leiden muss, ist es besser, einen gutausgestatteten Kopf zu haben - voller abrufbarer, vielseitig verwendbarer Erinnerungen, die einem analytischen Verstand jederzeit zur Verfügung stehen . Es fehlte nur ein Speicher. Dass es mir vergönnt war, in dem Fangnetz eines Lebens auch dies zu finden, empfinde ich als ziemlichen Glücksfall. Ich hoffe, ich habe etwas Sinnvolles damit angefangen.
Tony Judt
New York, Mai 2010
Copyright © S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
... weniger
Autoren-Porträt von Tony Judt
Tony Judt (1948-2010) studierte in Cambridge und Paris und lehrte in Cambridge, Oxford und Berkeley. Seit 1995 war er Erich-Maria-Remarque-Professor für Europäische Studien in New York. Er starb am 6. August 2010 in New York. Er war Mitglied der Royal Historical Society, der American Academy of Arts and Sciences und der John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Seine »Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart« (Bd. 18031) gilt als Klassiker der Geschichtsschreibung. Im Fischer Taschenbuch ist ebenfalls lieferbar: »Das vergessene 20. Jahrhundert« (Bd. 19186).Literaturpreise:2006: Bruno-Kreisky-Preis2007: Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis2007: Hannah-Arendt-Preis
Bibliographische Angaben
- Autor: Tony Judt
- 2014, 1. Auflage, 224 Seiten, Maße: 12,6 x 18,9 cm, Taschenbuch, Deutsch
- Übersetzung: Fienbork, Matthias
- Übersetzer: Matthias Fienbork
- Verlag: FISCHER Taschenbuch
- ISBN-10: 3596196299
- ISBN-13: 9783596196296
- Erscheinungsdatum: 25.06.2014
Kommentar zu "Das Chalet der Erinnerungen"



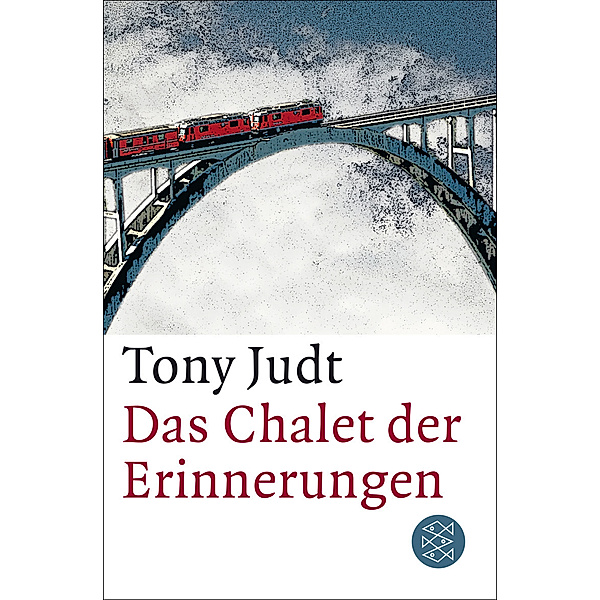
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Das Chalet der Erinnerungen".
Kommentar verfassen