Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter
Eine Biographie
Günter de Bruyns bahnbrechende Jean-Paul-Biographie in einer überarbeiteten Neufassung
Jean Paul war der wildeste und witzigste Erzähler der Goethezeit. Seine Romane sind atemberaubende Feuerwerke der Einbildungskraft. Sein gesamtes Werk steht im Zeichen...
Jean Paul war der wildeste und witzigste Erzähler der Goethezeit. Seine Romane sind atemberaubende Feuerwerke der Einbildungskraft. Sein gesamtes Werk steht im Zeichen...
lieferbar
versandkostenfrei
Buch (Gebunden)
22.70 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter “
Klappentext zu „Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter “
Günter de Bruyns bahnbrechende Jean-Paul-Biographie in einer überarbeiteten NeufassungJean Paul war der wildeste und witzigste Erzähler der Goethezeit. Seine Romane sind atemberaubende Feuerwerke der Einbildungskraft. Sein gesamtes Werk steht im Zeichen einer poetischen Freiheit, die einmalig ist in der deutschen Literatur. Günter de Bruyn folgt dem prekären Leben des berühmten Dichters und verknüpft es mit den Strömungen seiner Zeit von der Französischen Revolution bis zur Restaurationsepoche, von der Aufklärung bis zur Romantik. Ein Kabinettstück biographischer Erzählkunst, eines der schönsten Bücher zur Goethezeit.
Lese-Probe zu „Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter “
Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter von Günter de BruynWEIBER DIE MENGE
... mehr
Für Jean Paul, dessen geistige Entwicklung ganz im Banne der Aufklärung gestanden hatte, war Berlin auch schon von Bedeutung gewesen, ehe er 1792 durch das Ende der Selbständigkeit Ansbach-Bayreuths zum Preußen geworden war. Schon in jungen Jahren war Friedrich Nicolais »Allgemeine Deutsche Bibliothek«, die die Aufklärung in Deutschland von Berlin aus entscheidend geprägt hatte, seine Lektüre gewesen. König Friedrich II. war von ihm als Philosoph und toleranter Herrscher, nicht aber als Eroberer verehrt worden. Durch Karl Philipp Moritz und den Berliner Verleger Carl Matzdorff hatte er seine ersten Bucherfolge erzielen können. Eine Berlinerin sollte seine Ehefrau werden, und auch am Ende seines Lebens war sein Schaffen eng mit Berlin verbunden, weil die erste Ausgabe seiner Gesammelten Werke in 65 Bänden im Berliner Verlag von Georg Andreas Reimer erschien. Als er Berlin vom 23. Mai bis zum 24. Juni 1800 erstmalig besuchte, wurde er so viel gefeiert wie nie zuvor oder danach. Da jeder ihn sehen wollte, überhäufte man ihn mit Einladungen, so dass er kaum Zeit finden konnte, wie gewohnt lange Briefe zu schreiben, und die wenigen, die er schrieb, wirken so atemlos und so glücklich, wie jeder Tag dieser vier Wochen für ihn war. Über Berlin wusste er nur Gutes zu sagen. Hier schien ihm, im Gegensatz zu den kleineren Residenzen in Weimar und Hildburghausen, die Verbindung von Adel und Bürgertum enger, der Umgangston freier zu sein. Da man überall seine Bücher lobte und die Frauen ihn anhimmelten, schien ihm die Stadt von Jean-Paul-Lesern bevölkert. Als er wieder abreiste, war er entschlossen, sie zeitweilig zu seinem Wohnort zu machen; als ständiger Wohnsitz aber schien sie ihm nicht geeignet, weil ihrer Umgebung die Berge fehlten und ihm das heimische Bier. Schon in Weimar war in seinen Briefen an Otto oft der Wunsch nach einer Biersendung zu lesen gewesen. Das Bier hatte nämlich als Anregungsmittel für seine ernorme Arbeitsleistung den schlechter bekömmlichen starken Kaffee verdrängt. Dem starken Bierkonsum war es vermutlich zuzuschreiben, das seine hagere Gestalt von Jahr zu Jahr mehr in die Breite ging.
Der erste Band des »Titan«, an dem er in Weimar fieberhaft gearbeitet hatte, war gerade erschienen. In Hildburghausen, wo er die drei Schwestern der Königin Luise erlebt hatte, war die Widmung des Romans entstanden, die »Den vier schönen und edeln Schwestern auf dem Thron« lautet und durch die kleine Erzählung »Der Traum der Wahrheit« ergänzt wird, in der Aphrodite, Aglaja, Euphrosyne und Thalia vom Olymp herabsteigen und zu Sterblichen werden, die man nun Luise, Charlotte, Therese und Friederike nennt.
Gleich nach seiner Ankunft in Berlin ließ Jean Paul den »Titan« der Königin zukommen und hatte schon am nächsten Tag eine Einladung von ihr. Aus Sanssouci schrieb sie ihm am 29. Mai 1800: »Ich habe Ihren Titan erhalten und daraus mit Vergnügen ersehn, dass Sie noch immer fortfahren, ihre Zeitgenossen mit Wahrheiten zu unterhalten, die in dem Gewande romantischer Dichtkunst, mit welchem Sie sie zu bekleiden wissen, ihre Wirkung gewiss nicht verfehlen werden. Ihr Zweck, die Menschheit von mancher trüben Wolke zu befreien, ist zu schön, als dass Sie ihn nicht erreichen sollten, und es wird Mir daher auch eine Freude sein, Sie während Ihres Hierseins zu sehen und Ihnen zu zeigen, wie sehr ich bin Ihre wohlaffektionierte Luise.«
Schon am nächsten Tag gab sie für ihn ein Essen, bei dem er sich fragte, warum sie denn zwei Throne habe, denn zum Herrschen sei der »Thron der Schönheit« doch schon genug. »Ich sprach und aß in Sanssouci mit der gekrönten Aphrodite, deren Sprache und Umgang eben so reizend ist als ihre Musengestalt«, schrieb er an Gleim nach Halberstadt. »Sie stieg mit mir überall auf der heiligen Stätte herum, wo der große Geist des Erbauers sich und Europa beherrscht hatte. Geheiligt und gerührt stand ich in diesem Tempel des aufgeflogenen Adlers. Die Königin selber verehrt Friedrich so sehr, dass sie sagte, durch ihre Gegenwart würde diese Stelle entweiht, was wohl niemand zugibt, der Augen hat - für ihre. Sie nahm meine Dedikation und den Brief dabei mit vieler Freude auf. An der Tafel herrschte Unbefangenheit und Scherz.«
Er wohnte bei seinem Verleger Matzdorff an der Stechbahn, also direkt am Schloss. Vier Zimmer hatte er da zur Verfügung, »köstlich - seidene Stühle - Wachslichter - Erforschen jeden Wunsches«. Dass Matzdorff ihm zu Ehren ein »Pack Gelehrte« zum Essen eingeladen hatte, verdross ihn. Angenehmer dagegen, weil auch Frauen anwesend waren, fand er die extra für ihn angesetzten Theateraufführungen, die Essen bei den Familien von Ministern und einen Festempfang in der Freimaurerloge. »Ich besuchte keinen Gelehrtenklub, so oft ich auch dazu geladen worden, aber Weiber die Menge. Ich wurde angebetet von den Mädgen, die ich früher angebetet hätte. Himmel! welche Einfachheit, Offenheit, Bildung und Schönheit. Auf der herrlichen Insel Pickelswerder [gemeint ist: Pichelswerder] (2 ½ Meilen von Berlin) fand ich so viele Freundinnen auf einmal, dass es einen - ärgerte, weil jeder Anteil den andern aufhob ... Viele Haare erbeutete ich (eine ganze Uhrkette von 3 Schwestern Haaren) und viele gab mein eigner Scheitel her, so dass ich eben so wohl von dem leben wollte - wenn ich's verhandelte - was auf meiner Hirnschale wächset als was unter ihr.« Doch neben den in Scharen auftretenden Frauen beschäftigten ihn auch einzelne, wie Josephine von Sydow aus Hinterpommern, deren Briefe ihm die Entlobung erleichtert hatten und die nun allein seinetwegen tatsächlich für drei Tage nach Berlin kam.
Sie war in Südfrankreich geboren, hatte früh geheiratet und war mit ihrem Mann und zwei Söhnen nach Preußen gekommen, hatte sich scheiden lassen und den preußischen Offizier Hans-Friedrich Joachim von Sydow geheiratet, auf dessen Gütern in Hinterpommern sie lebte und unter dem Namen ihres ersten Mannes, de Montbart, Bücher in französischer Sprache schrieb. Die Lektüre des »Hesperus« hatte sie veranlasst, an Jean Paul zu schreiben. Der erste ihrer langen französisch geschriebenen Briefe beginnt mit dem schönen Satz: »Wäre ich Königin, so würde ich den Schöpfer des Hesperus zu meinem Premierminister küren. Wäre ich fünfzehn Jahre alt und könnte mich der Hoffnung hingeben, seine Klotilde [Gestalt aus dem »Hesperus«] zu sein, so wähnte ich mich glücklicher als eine Königin.« Aber auch die Einundvierzigjährige war von Jean Pauls liebevollen Antworten beseligt gewesen, so dass sich ein Liebesbriefwechsel entwickelt hatte, der die Zärtlichkeiten, die in Berlin getauscht werden sollten, schon vorweggenommen hatte, doch fiel die persönliche Begegnung dann enttäuschend aus. Josephine konnte nur drei Tage bleiben, weil ihr Mann, von dem sie erst im Jahr darauf geschieden wurde, von ihrem Ausflug nach Berlin nicht wissen durfte, und Jean Paul hatte im Trubel des Gefeiertwerdens für sie wenig Zeit. Es kam nicht zum Bruch, aber die Wirklichkeit wirkte auf beide Gemüter erkältend, so dass sich wie bei Charlotte, Emilie und Karoline der Briefwechsel zwar fortsetzte, aber sachlicher wurde und schließlich erstarb. In seiner moralisierenden Erzählung »Das heimliches Klaglied der jetzigen Männer« wurden Wesenszüge der Frau von Sydow verwertet, dann erging es ihr wie ihren Vorläuferinnen und denen, die noch nach ihr kamen und seiner Keuschheit gefährlicher wurden: einer Esther Bernard und einer Gräfin von Schlabrendorff.
Die jüngste seiner Verehrerinnen, eine äußerlich reizvolle Siebzehnjährige dagegen, beeindruckte ihn ihrer frühreifen Eitelkeit wegen sicher nur wenig. Sie hieß Wilhelmine, nannte sich aber Helmina, war eine Geborene von Klencke, hatte mit 16 Jahren den Freiherrn Karl Gustav von Hastfer geheiratet, war aber gerade dabei, sich wieder scheiden zu lassen. Wie ihre Großmutter, die berühmte Karschin, und ihre Mutter, Karoline Luise von Klencke, geborene Karsch, schrieb auch sie von Kindesbeinen an Gedichte und erlangte nach einer zweiten Heirat als Helmina von Chézy eine gewisse Berühmtheit, die aber weniger auf ihren zahlreichen Werken als auf ihren Freundschaften mit berühmten Leuten beruht. Ihr größter Erfolg wurde das Libretto, das sie für Carl Maria von Webers Oper »Euryanthe« schrieb. Als Vierzehnjährige hatte sie bei Daniel Chodowiecki, dem Freund ihrer Großmutter, die »Unsichtbare Loge« gelesen und den Plan gehabt, einen Roman in gleicher Manier zu verfassen, es aber dann doch unterlassen und sich damit begnügt, einen Brief an Jean Paul zu schreiben, in dem sie ihn mit Du anredete, die Absendung aber unterließ. Im Mai 1799 ließ sie dann Jean Paul diesen umformulierten langen Brief mit dem Bekenntnis, dass ihre Seele die seine suche und liebe, durch seinen Freund Ahlefeldt zukommen, so dass sie dem Verehrten also schon bekannt war, als er ein Jahr später nach Berlin kam. Eifrig war sie bemüht, sein Interesse zu erregen, schrieb ihm mehrere mit eignen Gedichten geschmückte Briefe, lud ihn zu Ausflügen ein und zum Essen in die Gipsgasse Nr. 12, wohin sie nach ihrem kurzen Ausflug in eine unglückliche Ehe wieder zu ihrer Mutter zurück gekehrt war. Er solle aber, schrieb sie ihm, eine schon verjährte galante Sitte des Adels aufgreifend, schon um 10 Uhr morgens kommen, »damit Sie sehen, wie ich an meiner Toilette die letzte Hand anlege«. Aber solche koketten und von der eignen Wichtigkeit überzeugten jungen Frauen rührten den Leichtzurührenden wenig. Und auch auf die vielen späteren Annäherungsversuche, die sie in Briefen ihr ganzes bewegtes Leben lang fortsetzte, ging er nur der Höflichkeit halber oder auch gar nicht ein.
Anders verhielt es sich mit der Schriftstellerin Esther Bernard, geb. Gad, einer aus Schlesien stammenden Jüdin, die er schon in Franzensbad persönlich kennengelernt hatte und nun, nachdem mehrere Briefe gewechselt worden waren, in Berlin wieder traf. Sie war eine geschiedene Frau mit drei Kindern, und obwohl sie nie eine Schule hatte besuchen können, war sie sehr gebildet und setzte sich in ihren Werken für das Recht der Frauen auf Bildung ein. Ihre Briefe an Jean Paul waren nicht weniger werbend als die anderer Frauen, wohl aber weniger sentimental. Über den Besuch bei ihr bekam Freund Otto, etwas rätselhaft, nur zu erfahren: »Im Tiergarten blieb ich bei der Bernard geborene
v. Gad eine Nacht und rauchte meine Pfeife und ging rein von dannen und Gott sei Dank, aber nicht mir.« Die schlimmste Versuchung aber, die der Junggeselle noch zu überstehen hatte, wartete nach seiner Berlin- Reise in Weimar auf ihn, und zwar in Gestalt der Henriette Gräfin von Schlabrendorff, die zehn Jahre jünger war als er. Theodor Fontane hat später, ohne von ihrer Beziehung zu Jean Paul zu wissen, in den »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« über die in dem südlich von Berlin gelegenen Gröben begüterte Familie von Schlabrendorff berichtet und dabei auch kurz über das Leben der Gräfin erzählt. Das berühmteste Mitglied der Familie war ein Gustav, der in Paris lebte, als Girondist von den Jakobinern zum Tode verurteilt wurde, diesem aber entgehen konnte, weil er, als er zum Schafott gefahren werden sollte, seine Stiefel nicht finden konnte, später vergessen wurde und durch den Sturz Robespierres schließlich befreit worden war. Dessen Bruder Heinrich, der zu Hause geblieben war, machte, wie Fontane berichtet, »als junger Offizier die Bekanntschaft eines durch Schönheit, Geist und Wissen ausgezeichneten Fräulein von Mütschephal, deren Vater in demselben Husarenregiment ein oberes Kommando bekleidete. Die Bekanntschaft führte bald zu Verlobung und Vermählung«. Eine Tochter und ein Sohn wurden geboren, aber da es sich vonseiten des Fräuleins um keine »Neigungsheirat« gehandelt hatte, führten »Geschmacks- und Meinungsverschiedenheiten« bald zum Zerwürfnis. »Man mied sich, und wenn der Graf in Gröben war, war die Gräfin in Berlin und umgekehrt. Aber auch in diesem Sich-Meiden empfanden beide Teile noch immer einen Zwang, und ihre Wünsche sahen sich erst erfüllt, als gegen Ende des Jahrhunderts aus der bloß örtlichen Trennung auch eine gesetzliche geworden war. Der Sohn verblieb dem Vater, die Tochter folgte der Mutter, welche letztere, noch eine schöne Frau, bald danach einem thüringischen Herrn von Schwendler ihre Hand reichte.« Das aber erst, nachdem Jean Paul ihr entgangen war.
Wie das geschah, bekam Freund Otto nach den sich ständig wiederholenden Klagen über die noch andauernde Ehelosigkeit ungewöhnlich genau zu erfahren, und zwar so: »Es ist freilich komisch, dass meine Treppe zum Ehebette (nach dir) unendlich-lang sein soll. Ich sorg' indes, in Berlin spring' ich hinein. Aber es muss bloß ein sanftes Mädgen darin liegen, das mir etwas kochen kann und das mit mir lacht und weint. Mehr begehr' ich gar nicht. Das Schicksal wird mich doch nicht in Goethes Pferdefuß-Stapfen jagen wollen, oft überleg' ich's freilich, aber es ist nicht daran zu denken; sogar in einer solchen Un-Ehe sänn' ich wieder auf Ehe. Ich muss und werde ein Mädgen heiraten, dessen ganze Sippschaft ein Freudenfest feiert, dass ich mich herabgelassen. Und doch spekulier' ich seit einiger Zeit fast mit auf Eingebrachtes; eine bemittelte Gräfin oder so etwas, denk' oft, kann sich in dich verschießen, und dann hieltest du dir ein Reitpferd - wenigstens den Reitknecht - und sprengtest nach Bayreuth, und überhaupt das Fett wüchse fort, das sich jetzt ansetzt.«
Das wurde am 26. August 1800 geschrieben, am 30. kam die Mitteilung, dass die junge schöne geschiedene Gräfin von Schlabrendorff mit ihm nach Gotha reisen wolle und er sich als Hasen sehe, »den der Jäger in immer näheren Kreisen umschleicht. Wir sind jetzt bei dem Händeanfassen mit eingemischten leichten Drucken. Ich halte mich passiv, und dabei kann keine Partei sehr riskieren«. Und als der Ausflug nach Gotha vorbei war, bekam der Freund am 11. September »mehr Süßsaures als Sauersüßes« zu lesen, darunter auch, dass der Dichter am Sonntagabend nach dem Essen mit der Gräfin das Kanapee »bewohnte - die schöne lange Gestalt, die durchaus harmonischen Teile, die gerade Nase und der feine zu besonnene gespannte, der Berlepsch ähnliche Mund, aus dem aber, zumal in der Liebesminutenzeit eine so ins Herz einsickernde Stimme bricht, dass ich sie in Gotha bat, mir es zu sagen, wo ich ihr nicht glauben dürfte, weil ich sonst der Stimme wegen nie wüsste, woran ich wäre - das alles neigte sich an meine Lippen. Unser Weg ging bergunter, d. h. schnell, wir legten in Sekunden Wochen zurück. Sie hatte noch die Hof-Brillanten an Fingern und am Halse; und als ich wahrlich an dem letzteren nicht weiter rückte als ein Rasiermesser an unserem - vergib meine Ungebundenheit, da ich heute toll bin - so schnallte sie das Kollier ab und machte ungebeten die tiefern schönen Spitzen auf. ... Ein vornehmes Wesen hat leichter ein Herz als ein Schnee Weltgen darüber (sogar das erriet ich im Hesperus). Ihr Globulus hatte die Farbe und - Weichheit von Wolken- flocken. ... Dabei blieb die Doppelglut, aber aus ihrem Anwinden und aus ihrem Wunsche, an mir zu schlafen und aus der Klage bei der letzten Umarmung, dass ich sie damit wieder aus der Ruhe gebracht, war leicht auf die Zukunft zu schließen. Ich sagte zu ihr: Du (denn das war bald da) weißt den Teufel, wie oft Männern ist. Und so ging ich - Ich hatte in meinem schlafenden Kopf fast das ganze schlagende Herz droben. Morgen Abend im gothaischen Gasthofe ist eine Sache entschieden (dacht ich die ganze Nacht), die es beinahe schon heute war. Einmal war ich fast dem Absagen der höllischen Himmelfahrt (oder der himmlischen Höllenfahrt) nahe. Aber ich fuhr doch mit ...« Aber trotz der nebeneinanderliegenden Zimmer mit Durchgangstüre erlag der Jüngling auch dieser Versuchung nicht. »Ich bin physisch-kalt und moralisch-heiss gegen Freundinnen«, war sein Erklärungsversuch.
Von Weimar hatte er in diesen Septembertagen schon innerlich Abschied genommen. Er nannte es eine »abgebrannte Stadt, auf deren heißer Asche ich noch schlafe. Jede Stadt scheint mir vor dem Auszug ebenso verkohlt. Die Poesie erbeutet bei dieser Völkerwanderung durch Örter und Herzen, aber das Herz wird ein armer Emigré; ich wollt' ich wär' ein Refugie in meiner Hochzeitsstube. « Den Winter wollte er in Berlin verbringen, diesem »glänzenden Juwel« unter den ihm bekannten Städten, dem aber leider die schöne Umgebung fehlte, worunter er eine mit Bergen verstand. Denn wie fast alle seine Zeitgenossen hatte er für die Schönheiten der Mark Brandenburg, von der man nur die sandigen Wege kannte, keinen Sinn. »Ja, Berlin ist eine Sandwüste, aber wo sonst findet man Oasen«, soll er zu Helmina von Chézy gesagt haben, und Fontane benutzte 80 Jahre später diese Metapher zur Charakterisierung von Jean Pauls Werken: »Sahara, aber welche Oasen darin!«
Aus Kostengründen wollte er in Berlin mit dem langjährigen Freund Hans Georg von Ahlefeldt zusammen wohnen, der also den Auftrag bekam, seine Stube dort einzurichten, deren wichtigstes Möbelstück neben dem Schreibtisch das »Repositorium (mehr ein Papier- als Bücherbrett)« war. »Mache überhaupt meine Einrichtung nicht kostbar; denn der Ehe, des Alters und der Gesundheit und der Literatur wegen muss ich sparen«. Seine Adresse war: die Hausnummer 22 der Neuen Friedrichstraße, die sich damals innerhalb der alten Befestigungen halbkreisförmig von der Friedrichbrücke bis zur Jannowitzbrücke hinzog und deren trauriger Rest heute Littenstraße heißt. Das Gartenhaus, in dem Jean Paul und Ahlefeldt wohnten, befand sich an der Kreuzung der Königsstraße, der heutigen Rathausstraße. Im Vorderhaus wohnten Henriette und Marcus Herz.
Copyright © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Für Jean Paul, dessen geistige Entwicklung ganz im Banne der Aufklärung gestanden hatte, war Berlin auch schon von Bedeutung gewesen, ehe er 1792 durch das Ende der Selbständigkeit Ansbach-Bayreuths zum Preußen geworden war. Schon in jungen Jahren war Friedrich Nicolais »Allgemeine Deutsche Bibliothek«, die die Aufklärung in Deutschland von Berlin aus entscheidend geprägt hatte, seine Lektüre gewesen. König Friedrich II. war von ihm als Philosoph und toleranter Herrscher, nicht aber als Eroberer verehrt worden. Durch Karl Philipp Moritz und den Berliner Verleger Carl Matzdorff hatte er seine ersten Bucherfolge erzielen können. Eine Berlinerin sollte seine Ehefrau werden, und auch am Ende seines Lebens war sein Schaffen eng mit Berlin verbunden, weil die erste Ausgabe seiner Gesammelten Werke in 65 Bänden im Berliner Verlag von Georg Andreas Reimer erschien. Als er Berlin vom 23. Mai bis zum 24. Juni 1800 erstmalig besuchte, wurde er so viel gefeiert wie nie zuvor oder danach. Da jeder ihn sehen wollte, überhäufte man ihn mit Einladungen, so dass er kaum Zeit finden konnte, wie gewohnt lange Briefe zu schreiben, und die wenigen, die er schrieb, wirken so atemlos und so glücklich, wie jeder Tag dieser vier Wochen für ihn war. Über Berlin wusste er nur Gutes zu sagen. Hier schien ihm, im Gegensatz zu den kleineren Residenzen in Weimar und Hildburghausen, die Verbindung von Adel und Bürgertum enger, der Umgangston freier zu sein. Da man überall seine Bücher lobte und die Frauen ihn anhimmelten, schien ihm die Stadt von Jean-Paul-Lesern bevölkert. Als er wieder abreiste, war er entschlossen, sie zeitweilig zu seinem Wohnort zu machen; als ständiger Wohnsitz aber schien sie ihm nicht geeignet, weil ihrer Umgebung die Berge fehlten und ihm das heimische Bier. Schon in Weimar war in seinen Briefen an Otto oft der Wunsch nach einer Biersendung zu lesen gewesen. Das Bier hatte nämlich als Anregungsmittel für seine ernorme Arbeitsleistung den schlechter bekömmlichen starken Kaffee verdrängt. Dem starken Bierkonsum war es vermutlich zuzuschreiben, das seine hagere Gestalt von Jahr zu Jahr mehr in die Breite ging.
Der erste Band des »Titan«, an dem er in Weimar fieberhaft gearbeitet hatte, war gerade erschienen. In Hildburghausen, wo er die drei Schwestern der Königin Luise erlebt hatte, war die Widmung des Romans entstanden, die »Den vier schönen und edeln Schwestern auf dem Thron« lautet und durch die kleine Erzählung »Der Traum der Wahrheit« ergänzt wird, in der Aphrodite, Aglaja, Euphrosyne und Thalia vom Olymp herabsteigen und zu Sterblichen werden, die man nun Luise, Charlotte, Therese und Friederike nennt.
Gleich nach seiner Ankunft in Berlin ließ Jean Paul den »Titan« der Königin zukommen und hatte schon am nächsten Tag eine Einladung von ihr. Aus Sanssouci schrieb sie ihm am 29. Mai 1800: »Ich habe Ihren Titan erhalten und daraus mit Vergnügen ersehn, dass Sie noch immer fortfahren, ihre Zeitgenossen mit Wahrheiten zu unterhalten, die in dem Gewande romantischer Dichtkunst, mit welchem Sie sie zu bekleiden wissen, ihre Wirkung gewiss nicht verfehlen werden. Ihr Zweck, die Menschheit von mancher trüben Wolke zu befreien, ist zu schön, als dass Sie ihn nicht erreichen sollten, und es wird Mir daher auch eine Freude sein, Sie während Ihres Hierseins zu sehen und Ihnen zu zeigen, wie sehr ich bin Ihre wohlaffektionierte Luise.«
Schon am nächsten Tag gab sie für ihn ein Essen, bei dem er sich fragte, warum sie denn zwei Throne habe, denn zum Herrschen sei der »Thron der Schönheit« doch schon genug. »Ich sprach und aß in Sanssouci mit der gekrönten Aphrodite, deren Sprache und Umgang eben so reizend ist als ihre Musengestalt«, schrieb er an Gleim nach Halberstadt. »Sie stieg mit mir überall auf der heiligen Stätte herum, wo der große Geist des Erbauers sich und Europa beherrscht hatte. Geheiligt und gerührt stand ich in diesem Tempel des aufgeflogenen Adlers. Die Königin selber verehrt Friedrich so sehr, dass sie sagte, durch ihre Gegenwart würde diese Stelle entweiht, was wohl niemand zugibt, der Augen hat - für ihre. Sie nahm meine Dedikation und den Brief dabei mit vieler Freude auf. An der Tafel herrschte Unbefangenheit und Scherz.«
Er wohnte bei seinem Verleger Matzdorff an der Stechbahn, also direkt am Schloss. Vier Zimmer hatte er da zur Verfügung, »köstlich - seidene Stühle - Wachslichter - Erforschen jeden Wunsches«. Dass Matzdorff ihm zu Ehren ein »Pack Gelehrte« zum Essen eingeladen hatte, verdross ihn. Angenehmer dagegen, weil auch Frauen anwesend waren, fand er die extra für ihn angesetzten Theateraufführungen, die Essen bei den Familien von Ministern und einen Festempfang in der Freimaurerloge. »Ich besuchte keinen Gelehrtenklub, so oft ich auch dazu geladen worden, aber Weiber die Menge. Ich wurde angebetet von den Mädgen, die ich früher angebetet hätte. Himmel! welche Einfachheit, Offenheit, Bildung und Schönheit. Auf der herrlichen Insel Pickelswerder [gemeint ist: Pichelswerder] (2 ½ Meilen von Berlin) fand ich so viele Freundinnen auf einmal, dass es einen - ärgerte, weil jeder Anteil den andern aufhob ... Viele Haare erbeutete ich (eine ganze Uhrkette von 3 Schwestern Haaren) und viele gab mein eigner Scheitel her, so dass ich eben so wohl von dem leben wollte - wenn ich's verhandelte - was auf meiner Hirnschale wächset als was unter ihr.« Doch neben den in Scharen auftretenden Frauen beschäftigten ihn auch einzelne, wie Josephine von Sydow aus Hinterpommern, deren Briefe ihm die Entlobung erleichtert hatten und die nun allein seinetwegen tatsächlich für drei Tage nach Berlin kam.
Sie war in Südfrankreich geboren, hatte früh geheiratet und war mit ihrem Mann und zwei Söhnen nach Preußen gekommen, hatte sich scheiden lassen und den preußischen Offizier Hans-Friedrich Joachim von Sydow geheiratet, auf dessen Gütern in Hinterpommern sie lebte und unter dem Namen ihres ersten Mannes, de Montbart, Bücher in französischer Sprache schrieb. Die Lektüre des »Hesperus« hatte sie veranlasst, an Jean Paul zu schreiben. Der erste ihrer langen französisch geschriebenen Briefe beginnt mit dem schönen Satz: »Wäre ich Königin, so würde ich den Schöpfer des Hesperus zu meinem Premierminister küren. Wäre ich fünfzehn Jahre alt und könnte mich der Hoffnung hingeben, seine Klotilde [Gestalt aus dem »Hesperus«] zu sein, so wähnte ich mich glücklicher als eine Königin.« Aber auch die Einundvierzigjährige war von Jean Pauls liebevollen Antworten beseligt gewesen, so dass sich ein Liebesbriefwechsel entwickelt hatte, der die Zärtlichkeiten, die in Berlin getauscht werden sollten, schon vorweggenommen hatte, doch fiel die persönliche Begegnung dann enttäuschend aus. Josephine konnte nur drei Tage bleiben, weil ihr Mann, von dem sie erst im Jahr darauf geschieden wurde, von ihrem Ausflug nach Berlin nicht wissen durfte, und Jean Paul hatte im Trubel des Gefeiertwerdens für sie wenig Zeit. Es kam nicht zum Bruch, aber die Wirklichkeit wirkte auf beide Gemüter erkältend, so dass sich wie bei Charlotte, Emilie und Karoline der Briefwechsel zwar fortsetzte, aber sachlicher wurde und schließlich erstarb. In seiner moralisierenden Erzählung »Das heimliches Klaglied der jetzigen Männer« wurden Wesenszüge der Frau von Sydow verwertet, dann erging es ihr wie ihren Vorläuferinnen und denen, die noch nach ihr kamen und seiner Keuschheit gefährlicher wurden: einer Esther Bernard und einer Gräfin von Schlabrendorff.
Die jüngste seiner Verehrerinnen, eine äußerlich reizvolle Siebzehnjährige dagegen, beeindruckte ihn ihrer frühreifen Eitelkeit wegen sicher nur wenig. Sie hieß Wilhelmine, nannte sich aber Helmina, war eine Geborene von Klencke, hatte mit 16 Jahren den Freiherrn Karl Gustav von Hastfer geheiratet, war aber gerade dabei, sich wieder scheiden zu lassen. Wie ihre Großmutter, die berühmte Karschin, und ihre Mutter, Karoline Luise von Klencke, geborene Karsch, schrieb auch sie von Kindesbeinen an Gedichte und erlangte nach einer zweiten Heirat als Helmina von Chézy eine gewisse Berühmtheit, die aber weniger auf ihren zahlreichen Werken als auf ihren Freundschaften mit berühmten Leuten beruht. Ihr größter Erfolg wurde das Libretto, das sie für Carl Maria von Webers Oper »Euryanthe« schrieb. Als Vierzehnjährige hatte sie bei Daniel Chodowiecki, dem Freund ihrer Großmutter, die »Unsichtbare Loge« gelesen und den Plan gehabt, einen Roman in gleicher Manier zu verfassen, es aber dann doch unterlassen und sich damit begnügt, einen Brief an Jean Paul zu schreiben, in dem sie ihn mit Du anredete, die Absendung aber unterließ. Im Mai 1799 ließ sie dann Jean Paul diesen umformulierten langen Brief mit dem Bekenntnis, dass ihre Seele die seine suche und liebe, durch seinen Freund Ahlefeldt zukommen, so dass sie dem Verehrten also schon bekannt war, als er ein Jahr später nach Berlin kam. Eifrig war sie bemüht, sein Interesse zu erregen, schrieb ihm mehrere mit eignen Gedichten geschmückte Briefe, lud ihn zu Ausflügen ein und zum Essen in die Gipsgasse Nr. 12, wohin sie nach ihrem kurzen Ausflug in eine unglückliche Ehe wieder zu ihrer Mutter zurück gekehrt war. Er solle aber, schrieb sie ihm, eine schon verjährte galante Sitte des Adels aufgreifend, schon um 10 Uhr morgens kommen, »damit Sie sehen, wie ich an meiner Toilette die letzte Hand anlege«. Aber solche koketten und von der eignen Wichtigkeit überzeugten jungen Frauen rührten den Leichtzurührenden wenig. Und auch auf die vielen späteren Annäherungsversuche, die sie in Briefen ihr ganzes bewegtes Leben lang fortsetzte, ging er nur der Höflichkeit halber oder auch gar nicht ein.
Anders verhielt es sich mit der Schriftstellerin Esther Bernard, geb. Gad, einer aus Schlesien stammenden Jüdin, die er schon in Franzensbad persönlich kennengelernt hatte und nun, nachdem mehrere Briefe gewechselt worden waren, in Berlin wieder traf. Sie war eine geschiedene Frau mit drei Kindern, und obwohl sie nie eine Schule hatte besuchen können, war sie sehr gebildet und setzte sich in ihren Werken für das Recht der Frauen auf Bildung ein. Ihre Briefe an Jean Paul waren nicht weniger werbend als die anderer Frauen, wohl aber weniger sentimental. Über den Besuch bei ihr bekam Freund Otto, etwas rätselhaft, nur zu erfahren: »Im Tiergarten blieb ich bei der Bernard geborene
v. Gad eine Nacht und rauchte meine Pfeife und ging rein von dannen und Gott sei Dank, aber nicht mir.« Die schlimmste Versuchung aber, die der Junggeselle noch zu überstehen hatte, wartete nach seiner Berlin- Reise in Weimar auf ihn, und zwar in Gestalt der Henriette Gräfin von Schlabrendorff, die zehn Jahre jünger war als er. Theodor Fontane hat später, ohne von ihrer Beziehung zu Jean Paul zu wissen, in den »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« über die in dem südlich von Berlin gelegenen Gröben begüterte Familie von Schlabrendorff berichtet und dabei auch kurz über das Leben der Gräfin erzählt. Das berühmteste Mitglied der Familie war ein Gustav, der in Paris lebte, als Girondist von den Jakobinern zum Tode verurteilt wurde, diesem aber entgehen konnte, weil er, als er zum Schafott gefahren werden sollte, seine Stiefel nicht finden konnte, später vergessen wurde und durch den Sturz Robespierres schließlich befreit worden war. Dessen Bruder Heinrich, der zu Hause geblieben war, machte, wie Fontane berichtet, »als junger Offizier die Bekanntschaft eines durch Schönheit, Geist und Wissen ausgezeichneten Fräulein von Mütschephal, deren Vater in demselben Husarenregiment ein oberes Kommando bekleidete. Die Bekanntschaft führte bald zu Verlobung und Vermählung«. Eine Tochter und ein Sohn wurden geboren, aber da es sich vonseiten des Fräuleins um keine »Neigungsheirat« gehandelt hatte, führten »Geschmacks- und Meinungsverschiedenheiten« bald zum Zerwürfnis. »Man mied sich, und wenn der Graf in Gröben war, war die Gräfin in Berlin und umgekehrt. Aber auch in diesem Sich-Meiden empfanden beide Teile noch immer einen Zwang, und ihre Wünsche sahen sich erst erfüllt, als gegen Ende des Jahrhunderts aus der bloß örtlichen Trennung auch eine gesetzliche geworden war. Der Sohn verblieb dem Vater, die Tochter folgte der Mutter, welche letztere, noch eine schöne Frau, bald danach einem thüringischen Herrn von Schwendler ihre Hand reichte.« Das aber erst, nachdem Jean Paul ihr entgangen war.
Wie das geschah, bekam Freund Otto nach den sich ständig wiederholenden Klagen über die noch andauernde Ehelosigkeit ungewöhnlich genau zu erfahren, und zwar so: »Es ist freilich komisch, dass meine Treppe zum Ehebette (nach dir) unendlich-lang sein soll. Ich sorg' indes, in Berlin spring' ich hinein. Aber es muss bloß ein sanftes Mädgen darin liegen, das mir etwas kochen kann und das mit mir lacht und weint. Mehr begehr' ich gar nicht. Das Schicksal wird mich doch nicht in Goethes Pferdefuß-Stapfen jagen wollen, oft überleg' ich's freilich, aber es ist nicht daran zu denken; sogar in einer solchen Un-Ehe sänn' ich wieder auf Ehe. Ich muss und werde ein Mädgen heiraten, dessen ganze Sippschaft ein Freudenfest feiert, dass ich mich herabgelassen. Und doch spekulier' ich seit einiger Zeit fast mit auf Eingebrachtes; eine bemittelte Gräfin oder so etwas, denk' oft, kann sich in dich verschießen, und dann hieltest du dir ein Reitpferd - wenigstens den Reitknecht - und sprengtest nach Bayreuth, und überhaupt das Fett wüchse fort, das sich jetzt ansetzt.«
Das wurde am 26. August 1800 geschrieben, am 30. kam die Mitteilung, dass die junge schöne geschiedene Gräfin von Schlabrendorff mit ihm nach Gotha reisen wolle und er sich als Hasen sehe, »den der Jäger in immer näheren Kreisen umschleicht. Wir sind jetzt bei dem Händeanfassen mit eingemischten leichten Drucken. Ich halte mich passiv, und dabei kann keine Partei sehr riskieren«. Und als der Ausflug nach Gotha vorbei war, bekam der Freund am 11. September »mehr Süßsaures als Sauersüßes« zu lesen, darunter auch, dass der Dichter am Sonntagabend nach dem Essen mit der Gräfin das Kanapee »bewohnte - die schöne lange Gestalt, die durchaus harmonischen Teile, die gerade Nase und der feine zu besonnene gespannte, der Berlepsch ähnliche Mund, aus dem aber, zumal in der Liebesminutenzeit eine so ins Herz einsickernde Stimme bricht, dass ich sie in Gotha bat, mir es zu sagen, wo ich ihr nicht glauben dürfte, weil ich sonst der Stimme wegen nie wüsste, woran ich wäre - das alles neigte sich an meine Lippen. Unser Weg ging bergunter, d. h. schnell, wir legten in Sekunden Wochen zurück. Sie hatte noch die Hof-Brillanten an Fingern und am Halse; und als ich wahrlich an dem letzteren nicht weiter rückte als ein Rasiermesser an unserem - vergib meine Ungebundenheit, da ich heute toll bin - so schnallte sie das Kollier ab und machte ungebeten die tiefern schönen Spitzen auf. ... Ein vornehmes Wesen hat leichter ein Herz als ein Schnee Weltgen darüber (sogar das erriet ich im Hesperus). Ihr Globulus hatte die Farbe und - Weichheit von Wolken- flocken. ... Dabei blieb die Doppelglut, aber aus ihrem Anwinden und aus ihrem Wunsche, an mir zu schlafen und aus der Klage bei der letzten Umarmung, dass ich sie damit wieder aus der Ruhe gebracht, war leicht auf die Zukunft zu schließen. Ich sagte zu ihr: Du (denn das war bald da) weißt den Teufel, wie oft Männern ist. Und so ging ich - Ich hatte in meinem schlafenden Kopf fast das ganze schlagende Herz droben. Morgen Abend im gothaischen Gasthofe ist eine Sache entschieden (dacht ich die ganze Nacht), die es beinahe schon heute war. Einmal war ich fast dem Absagen der höllischen Himmelfahrt (oder der himmlischen Höllenfahrt) nahe. Aber ich fuhr doch mit ...« Aber trotz der nebeneinanderliegenden Zimmer mit Durchgangstüre erlag der Jüngling auch dieser Versuchung nicht. »Ich bin physisch-kalt und moralisch-heiss gegen Freundinnen«, war sein Erklärungsversuch.
Von Weimar hatte er in diesen Septembertagen schon innerlich Abschied genommen. Er nannte es eine »abgebrannte Stadt, auf deren heißer Asche ich noch schlafe. Jede Stadt scheint mir vor dem Auszug ebenso verkohlt. Die Poesie erbeutet bei dieser Völkerwanderung durch Örter und Herzen, aber das Herz wird ein armer Emigré; ich wollt' ich wär' ein Refugie in meiner Hochzeitsstube. « Den Winter wollte er in Berlin verbringen, diesem »glänzenden Juwel« unter den ihm bekannten Städten, dem aber leider die schöne Umgebung fehlte, worunter er eine mit Bergen verstand. Denn wie fast alle seine Zeitgenossen hatte er für die Schönheiten der Mark Brandenburg, von der man nur die sandigen Wege kannte, keinen Sinn. »Ja, Berlin ist eine Sandwüste, aber wo sonst findet man Oasen«, soll er zu Helmina von Chézy gesagt haben, und Fontane benutzte 80 Jahre später diese Metapher zur Charakterisierung von Jean Pauls Werken: »Sahara, aber welche Oasen darin!«
Aus Kostengründen wollte er in Berlin mit dem langjährigen Freund Hans Georg von Ahlefeldt zusammen wohnen, der also den Auftrag bekam, seine Stube dort einzurichten, deren wichtigstes Möbelstück neben dem Schreibtisch das »Repositorium (mehr ein Papier- als Bücherbrett)« war. »Mache überhaupt meine Einrichtung nicht kostbar; denn der Ehe, des Alters und der Gesundheit und der Literatur wegen muss ich sparen«. Seine Adresse war: die Hausnummer 22 der Neuen Friedrichstraße, die sich damals innerhalb der alten Befestigungen halbkreisförmig von der Friedrichbrücke bis zur Jannowitzbrücke hinzog und deren trauriger Rest heute Littenstraße heißt. Das Gartenhaus, in dem Jean Paul und Ahlefeldt wohnten, befand sich an der Kreuzung der Königsstraße, der heutigen Rathausstraße. Im Vorderhaus wohnten Henriette und Marcus Herz.
Copyright © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
... weniger
Autoren-Porträt von Günter De Bruyn
de Bruyn, GünterGünter de Bruyn wurde am 1. November 1926 in Berlin geboren und lebte seit 1969 im brandenburgischen Görsdorf bei Beeskow als freier Schriftsteller. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Heinrich-Böll-Preis, dem Thomas-Mann-Preis, dem Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung, dem Eichendorff-Literaturpreis und dem Johann-Heinrich-Merck-Preis. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören u.a. die beiden kulturgeschichtlichen Essays »Als Poesie gut« und »Die Zeit der schweren Not«, die autobiographischen Bände »Zwischenbilanz« und »Vierzig Jahre« sowie die Romane »Buridans Esel« und »Neue Herrlichkeit«. Zuletzt erschien bei S. Fischer der Titel »Der neunzigste Geburtstag« (2018). Günter de Bruyn starb am 4. Oktober 2020 in Bad Saarow.Literaturpreise:Heinrich-Mann-Preis (1964)Lion-Feuchtwanger-Preis (1982)Ehrengabe des Kulturkreises des Bundesverbandes der deutschen Industrie (1987)Thomas-Mann-Preis der Stadt Lübeck (1989)Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln (1990)Ehrendoktor der Universität Freiburg (1990)Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste (1993)Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (1996)Brandenburgischer Literaturpreis (1996)Jean-Paul-Preis (1997)Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität, Berlin (1998)Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik (2000)Friedrich-Schiedel-Literaturpreis (2000)Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung (2002)Jacob-Grimm-Preis für Deutsche Sprache (2006)Hanns Martin Schleyer-Preis (2007)Hoffmann-von-Fallersleben-Preis (2008)Preis für deutsche und europäische Verständigung der Deutschen Gesellschaft e.V. (2010)Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay (2011)
Bibliographische Angaben
- Autor: Günter De Bruyn
- 2013, 1. Auflage, 352 Seiten, Maße: 13,1 x 21,1 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH
- ISBN-10: 3100096444
- ISBN-13: 9783100096449
- Erscheinungsdatum: 19.02.2013
Rezension zu „Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter “
[eine] an prägnanter Plastizität und erzählerischer Eleganz kaum überbietbare Lebensbeschreibung Jean Pauls Kirsten Voigt NZZ am Sonntag 20130331
Pressezitat
[eine] an prägnanter Plastizität und erzählerischer Eleganz kaum überbietbare Lebensbeschreibung Jean Pauls Kirsten Voigt NZZ am Sonntag 20130331
Kommentar zu "Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter"



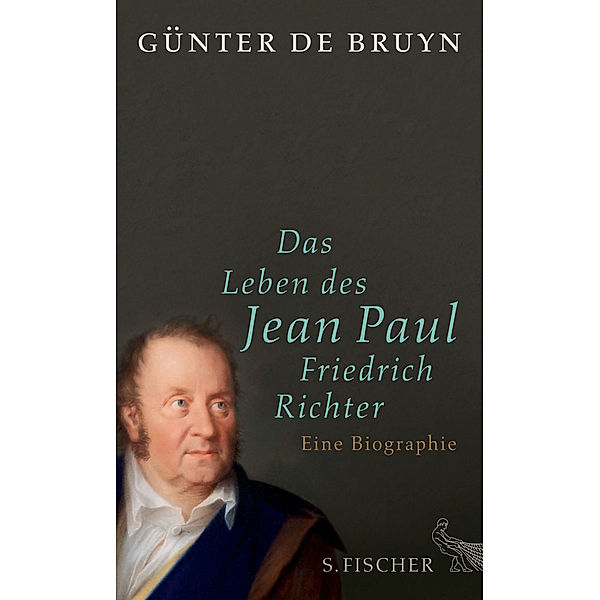
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter".
Kommentar verfassen