Dschungelkind
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung

Mit 5 Jahren kommt Sabine Kuegler als Tochter deutscher Missionare nach West-Papua - zum Stamm der Fayu, der heute noch wie in der Steinzeit lebt. Das Mädchen lebt, denkt und fühlt wie eine Fayu. Doch mit 17 wird sie auf ein Schweizer Internat geschickt und erlebt zum ersten Mal die Zivilisation. Gegensätzlicher können Erfahrungen nicht sein.
''Liest sich wie eine Kombination aus Robinson Crusoe und Pippi Langstrumpf.''
Hamburger Abendblatt
Bis sie siebzehn war, kannte sie keine Autos, kein Fernsehen und keine Geschäfte. Sie spielte nicht mit Puppen, sondern schwamm mit Krokodilen im Fluss - und erlebte schon früh die alten Rituale des Tötens. Die Natur war ihr Spielplatz, der Dschungel ihre Heimat, der Himmel ihr Dach.
Heute, nach Jahren in Europa, ist ihre Seele gefangen zwischen zwei Kulturen. Sabine Kuegler weiß, dass sie zurückkehren muss - zurück in eine Welt, die für viele nicht mehr existiert.
Dschungelkind von SabineKuegler
LESEPROBE
Meine Geschichte
Ich möchte eineGeschichte erzählen, die Geschichte eines Mädchens, das in einem anderenZeitalter aufwuchseine Geschichte von Liebe, Hass, Vergebung, Brutalität, undvon der Schönheit des Lebens. Es ist eine wahre Geschichte es ist meineGeschichte.
Es muss AnfangOktober gewesen sein. Ich bin 17 Jahre alt, trage eine dunkle Hose, die mir zugroß ist, einen gestreiften Pullover und Halbschuhe, die überall drücken undmir das Gefühl geben, meine Füße werden zerquetscht. Sie tun weh, weil ich biszu diesem Zeitpunkt in meinem Leben ganz selten Schuhe getragen habe. MeineJacke sieht aus wie aus dem vorigen Jahrhundert (und das ist sie wahrscheinlichauch). Dunkelblau mit einer Kapuze, die mir, als ich sie aufsetze, über die Augenfällt. Es sind Kleider, die ich geschenkt bekommen habe.
Mir ist eiskalt,ich zittere, meine Hände und Ohren kann ich kaum noch spüren. Ich trage wederein Unterhemd noch Handschuhe, Schal oder eine Mütze. Ich habe mich nicht mehrdaran erinnert, wie man sich im Winter anzieht. Ich kenne den Winter kaum.
Ich stehe auf demHauptbahnhof in Hamburg. Eisiger Wind pfeift über den Bahnsteig. Es ist kurznach neun oder zehn, ich weiß es nicht mehr genau. Man hatte mich am Bahnhofabgesetzt und mir erklärt, wie ich den richtigen Zug finde alles mit vielenZahlen verbunden. Nach einiger Zeit bin ich tatsächlich auf dem richtigenBahnsteig angekommen; es ist die Nummer 14.
Ich trage eineTasche bei mir, die ich ganz fest an mich drücke, und einen Koffer, der dasWenige enthält, das ich mitnehmen konnte. In meiner Hand der Fahrschein, aufden ich zum hundertsten Mal schaue, um mir noch einmal die Nummer meines Waggonseinzuprägen.
Ich bin nervös,all meine Sinne sind auf Hochtouren. Ich beobachte misstrauisch die Menschen ummich herum und bin bereit zuzuschlagen, sollte mich jemand angreifen. Aberniemand scheint mich zu beachten.
Es ist alles soneu für mich, so fremd, dunkel und bedrohlich. Ich schaue die Gleise entlang,als ich eine Durchsage höre. Nur zum Teil verstehe ich, was gesagt wird, soviel Lärm ist um mich herum! Ich beobachte, wie sich das Gefährt nähert, dasmich in mein neues Leben bringen soll. Meine Augen
werden immergrößer, denn heute, mit 17 Jahren, sehe ich zum ersten Mal einen richtigen Zug.
Er kommt mit sohoher Geschwindigkeit auf mich zu, dass ich vor Schreck ein paar Schrittezurückweiche. Dieser Zug sieht anders aus als die Züge, die ich in Bücherngesehen habe. Er ist nicht mit Blumen geschmückt, es kommt kein Rauch aus einemSchornstein, und die Farbe ist auch anders. Dieser
Zug ist so großund unheimlich wie ein langer weißer Wurm, der aus einem schwarzen Lochhervorkriecht.
Als er schließlichzum Stehen kommt, beginnen die Menschen wie besessen einzusteigen. Ich verharrenoch einige Sekunden unbeweglich, vergesse für einen Moment die Kälte und schauedieses riesige Fahrzeug vor mir an. Neugier und Angst befallen michgleichzeitig. Da bemerke ich eine Nummer an
der Seite desWaggons vor mir. Ich vergleiche sie mit der auf meinem Fahrschein und sehe,dass sie nicht übereinstimmen. Ich wende mich nach rechts und nach links, derZug scheint unendlich lang. Kopflos beginne ich zum hinteren Teil des Zuges zulaufen. Die Nummern der Waggons haben nichts mit denen auf meiner Fahrkarte zutun. Plötzlich höre ich einen lauten Pfiff. Ich schrecke zusammen und schauemich um. Ein Mann in Uniform hält einen eigenartigen Stab nach oben. Panikkommt in mir hoch, als ich merke, dass es etwas mit der Abfahrt zu tun hat, undschnell springe ich durch die nächste Tür ins Innere. Gerade rechtzeitig, dennschon beginnt der Zug sich zu bewegen.
Ich stehe einenAugenblick da und weiß nicht, was ich machen soll. Mein Herz klopft so stark,als wolle es zerspringen. Da bemerke ich, dass es Türen gibt, die esermöglichen, durch die einzelnen Wagen zu gehen. Ich laufe los nach vorn. Ich fangean zu schwitzen und sorge dafür, dass ich bloß keinen Augenkontakt mit Fremdenaufnehme. Die Waggons scheinen niemals aufzuhören, es geht weiter und weiter.Plötzlich stehe ich in einem Abteil, das schöner aussieht als die, die ich geradedurchlaufen habe - es ist die Erste Klasse. Es gibt keinen Durchgang mehr.Ratlos bleibe ich stehen. Meine Augen füllen sich mit Tränen.
In diesem Momenttaucht ein Mann aus einem Abteil auf und sieht mich. Ich wende mich schnell ab,aber er kommt auf mich zu. Er fragt, ob er mir helfen kann. Ich sehe ihn an, erscheint Ende dreißig zu sein, dunkler Anzug, braune Haare und hellblaue Augen.Ich zeige ihm meine Fahrkarte und frage ihn nach dem Waggon mit dieser Nummer.Gerade kommt auch ein Mann in Uniform den Gang herunter. Nach einem Blick aufmeinen Fahrschein teilt er mir gleichgültig mit, dass ich im falschen Zug sei.Mein Herz steht still, ich werde ganz blass im Gesicht. Der Schaffner mussmeine Angst gesehen haben, weil er mich schnell beruhigt und mir erklärt, dasses ausnahmsweise zwei Züge gibt, die beide zum selben Zielort
fahren.
Ich frage ihn, wasich jetzt machen soll, während ich mit immer größerer Panik kämpfe. Er erklärtmir, dass wir bald anhalten werden und ich dann in den nächsten Zug aufdemselben Gleis einsteigen kann.
Nachdem er dieFahrkarte des Mannes mit den blauen Augen kontrolliert hat, der noch immerneben uns steht, verabschiedet sich der Schaffner und geht weiter. Ich schaueihm nach, spüre einen großen Knoten im Hals und fühle mich sofort wieder völlighilflos und ausgeliefert. Ich stehe allein mit einem fremden weißen Mann ineinem halbdunklen Waggon, in einem fremden Land. Der Gedanke, dass er michvergewaltigen könnte oder sogar töten, um mich zu bestehlen, schießt durchmeinen Kopf. All die Geschichten, die ich über die Gefahren der modernen Weltgehört habe, scheinen Realität zu werden. Wie kann ich mich schützen? Ich habeweder Pfeil und Bogen noch ein Messer bei mir.
Der fremde Mannfragt mich mit einem mitleidigen Lächeln, ob ich nicht in sein Abteil kommenmöchte, um dort auf meine Haltestelle zu warten. Ich schüttle den Kopf undantworte, dass ich lieber hier im Gang warte. Er versucht es noch einmal mitder Bemerkung, dass es im Abteil aber viel bequemer sei. Jetzt bin ich mirsicher, dass er mir etwas antun will. Ich sage nein, nehme meinen Koffer undfliehe in den kleinen Freiraum zwischen den Waggons. Er folgt mir und fragt,woher ich komme. Aus Hamburg, antworte ich mit zitternder Stimme.
Zu meiner großenErleichterung verlangsamt der Zug in diesem Moment seine Geschwindigkeit. Ichstehe vor der Tür, der fremde Mann noch immer hinter mir. Ich bete, dass er wiederweggehen möge. Als der Zug zum Stehen kommt, will ich aussteigen, aber die Türöffnet sich nicht. Was jetzt? Muss ich irgendwo drücken oder schieben? Ichrüttle an den Griffen, aber es passiert nichts. Da drängt sich der Fremde anmir
vorbei, drehteinen roten Hebel, und die Zugtür öffnet sich. Was für eine Erleichterung, alsich endlich den Bahnsteig vor mir sehe! Noch ein Schritt, und ich bin außerGefahr. Ich bedanke mich schnell und trete ins Freie.
Die Türenschließen sich hinter mir, und ich sehe noch die dunkle Gestalt des Fremden amFenster des abfahrenden Zuges. Ich schaue mich um, ich bin allein, kein andererMensch auf dem Bahnsteig. Es ist dunkel außer ein paar vereinzelten Lichternüber mir. Die Kälte holt mich wieder ein. Ich fange zu zittern an, ein Schmerz,den ich vorher nicht kannte. Meine Zähne klappern, ich sehne mich nach derschwülen Hitze des Tropenwaldes und der heißen Sonne. Ich weiß nicht, wo ich binoder was ich tun soll, wenn der nächste Zug nicht kommt. Werde ich hiererfrieren?
Es kommt mir wieeine Ewigkeit vor, doch dann hält er vor mir. Zu meiner Erleichterung finde ichdiesmal sogar den richtigen Waggon. Ich steige ein, sehe einen freien Platz undvermute, dass ich meinen Koffer in dem großen Fach an der Seite des Gangesabstellen muss, wo auch alle anderen stehen.
Ich lasse mein Habund Gut zurück in der Gewissheit, dass es gestohlen wird, weil ich von meinemSitz aus kein Auge darauf haben kann. Doch das ist mir in diesem Moment völlig egal.Meine Beine sind so schwach, meine Füße schmerzen, ich bin müde undverzweifelt.
Als ich endlichsitze, suche ich die Gurte, um mich anzuschnallen. Ich finde nichts und sucheauf dem Sitz neben mir, aber auch dort ist nichts. Da bemerke ich, dass keinerder Fahrgäste einen Gurt trägt. Das scheint mir sehr unsicher und gefährlich,aber es muss wohl so sein. Dies hier ist ein fremdes Land ein Land, dem ichnur auf dem Papier angehöre. Die Bewegung des Zuges wirkt beruhigend auf mich.Ich ziehe meine Schuhe aus und setze mich auf meine Füße, um sie zu wärmen. DieJacke fest um mich geschlungen, schaue ich aus dem Fenster und betrachte denMond, der hier so dunkel und klein wirkt, so ärmlich, als sei er am Ausblühen.Meine Augen füllen sich mit Tränen, die an meinen kalten Wangen
herunterlaufen.Ich sehne mich nach dem Mond, den ich kenne, einem stolzen Mond voller Kraftund Leben, der mit so großer Helligkeit leuchtet, dass ich nachts meineneigenen Schatten sehen kann. Ich lehne meinen Kopf zurück und schließe dieAugen.
Der Zug fährtimmer schneller, meine Gedanken rasen mit ihm. Im Geiste verlasse ich diesendunklen, kalten Ort. Ich fliege zurück in die Vergangenheit. Blaue, weiße undgrüne Farben ziehen vor meinem inneren Auge vorüber. Ich fliege in die Wärme,die Sonne lacht, ihre Strahlen fliegen mit mir, fangen mich ein, tanzen um michherum und umhüllen meinen Körper mit wohliger Glut. Ich sehe grüne Felder,
bunte Städtevoller Menschen, tiefe, dunkle Täler, durchschnitten von schmalen Flüssen, undgewaltige, dichte Wälder.
Dann das großeMeer, das sich in seiner Unendlichkeit bis zum Horizont erstreckt. Jetzt seheich meinen über alles geliebten Urwald vor mir: grüne, stolze Bäume, so weitdas Auge reicht; ein wunderschön ausgebreiteter smaragdfarbener Teppich, sanftund doch mächtig, grün und doch voll von Farben jeder Art. Ein Anblick, der sichmir schon Hunderte Male bot, der mich aber jedes Mal wieder mit Bewunderung undStaunen erfüllt. Der mächtige Dschungel von Irian Jaya mein Zuhause, dasVerlorene Tal.
© DroemerKnaur
Interviewmit SabineKuegler
Als ihreEltern, zwei Missionare und Sprachforscher, sie mit nach West-Papua(Indonesien) nahmen, war Sabine Kuegler gerade sieben Jahre alt. Zusammen mitdem Stamm der Fayu, Giftspinnen und Krokodilen verbrachte Sie ihre Kindheitmitten im Dschungel. Jetzt hat sie ihr Leben als „Dschungelkind“zum Bestseller gemacht.
Siehaben sehr lange nicht über Ihre Kindheit gesprochen. Warum nicht?
Wenn jemand mich gefragthat: „Woher kommen Sie?“, habe ich immer gesagt: „AusHamburg.“ Ich habe das gemacht, weil ich nicht anders sein wollte, weilich immer versucht habe, mich hier zu integrieren. Ich habe mich nichtgeschämt für meine Kindheit, aber wenn ich gesagt habe, ich komme ausdem Dschungel, dann war sofort die Stimmung anders. Ich habe gedacht, ichkönnte mich so besser anpassen, aber das Gegenteil war der Fall. Das habeich in den letzten zwei Jahren erst gemerkt, als ich anfing, meine Geschichtezu erzählen. OK, ich habe eine andere Kindheit gehabt, eine Kindheit, dieich niemals tauschen würde, weil sie für mich persönlich sehrschön war. Und jetzt gucken mich die Leute auch nicht mehr komisch an,denn sie wissen ja, ich bin erst seit 2 oder 3 Jahren in Deutschland und dakann man eben nicht alles wissen.
Der Stamm der Fayu, beidem Sie lebten, ist angeblich bekannt für Kannibalismus undBrutalität. Wie haben Sie das erlebt und wie wurde Ihre Familieaufgenommen?
Ich habe Brutalitätgesehen, aber ich empfand es nicht als brutal. Ich persönlich empfand dieMenschen hier in der westlichen Welt als viel brutaler. Das hängtvielleicht auch damit zusammen, dass ich damals noch ein Kind war. Die Fayuhaben Krieg geführt, und ich habe gemerkt, dass sie sehr viel Angst hattenund sehr in Angst lebten. Mir und meiner Familie gegenüber waren siejedoch sehr, sehr nett, denn wir standen nicht unter dem Blutrachesystem.Untereinander haben sich die einzelnen Gruppen auch geschützt. Der Verbundinnerhalb der Familie war sehr stark, nur das Verhalten gegenüber denFeinden war brutal.
Kannibalismus habe ich inmeinem Buch übrigens nur in einem einzigen Satz erwähnt, der vonMedien sofort aufgebauscht wurde. Persönlich habe ich nie Kannibalismusmiterlebt. Ich bezweifle auch, dass die Fayu so etwas während unserer Zeitim Dschungel gemacht haben. Was viele Leute auch nicht wissen: Im Urwald wurdeman nicht ohne Grund umgebracht. Man hat niemanden umgebracht, noch nicht malTiere, ohne Grund. Nur wenn jemand ein Tabu gebrochen hatte, dann hat man ihnumgebracht.
Wie sah Ihr Alltag imDschungel aus?
Wir sind aufgestanden, wenndie Sonne aufgegangen ist. Wir hatten ja keine Elektrizität, das war sozwischen sechs und sieben Uhr morgens. Zuerst haben wir gefrühstückt,dann mussten wir Schularbeiten machen bis mittags. Wir hatten englischenUnterricht, haben aber mit unseren Eltern deutsch gesprochen und mit denEingeborenen die Fayu-Sprache. Man mischt auch schon mal zwei Sprachen. Wenndie zum Beispiel etwas hatten,wofür kein Wort da war, haben wir auch schon mal das indonesische Wortbenutzt, das sie dann auch benutzt haben.
Nachmittags sind wir nachdraußen gegangen und haben bis abends gespielt. Wenn die Sonne unterging,sind wir heimgegangen und haben noch was gegessen, wenn wir Hunger hatten. Wir hatten zwei Kerosinlampenin der Hütte und haben zum Beispiel noch Spiele gespielt oder Geschichtenerzählt und dann sind wir schätzungsweise so gegen acht ins Bettgegangen. Und das jeden Tag. Außer wenn es geregnet hat, dann konnten wirnicht nach draußen und haben uns sehr, sehr gelangweilt.
Ihre Eltern sindMissionare. Wie muss man sich diese Missionarsarbeit konkret vorstellen?
Die Welt der Missionare hatsich in den letzten 50 Jahren sehr verändert. Es ist nicht mehr so wie esfrüher war, als Missionare die Bibel hochhielten und sagten, ihr seid alleSünder. Wer sich nicht bekehren lässt, kommt in die Hölle. Dieheutigen Missionare sind sehr gebildete Menschen, Sprachwissenschaftler,Anthropologen, Ärzte, Entwicklungshelfer, die zusätzlich noch einenGlauben haben. Sie sind am Schutz der Menschen und des Urwaldes interessiertund setzen sich mit der Kultur auseinander. Meine Eltern haben immer gesagt,dass man Glauben nicht predigen kann. Man kann einem Menschen nichtsaufzwingen, denn Glaube muss von Herzen kommen. Man muss das leben, woran manglaubt, und den Menschen ein Beispiel geben.
Es gab aber sicher dochauch Gelegenheiten, bei denen zwei ganz verschiedene Kulturen und Glaubenaufeinander gestoßen sind. Zum Beispiel bei der Bestattung der Toten inden Hütten.
Mein Vater hat sich niemalsin die Kultur der Fayu eingemischt, weil er der Meinung war, wenn sie etwasändern wollen, müssen sie das von selbst tun. Dass die Fayu ihreToten in ihren Hütten bestatten, empfand ich nie als eigenartig und ichhabe auch nie gesehen, dass meine Eltern das Gesicht dabei verzogen haben. MeinVater hat sich natürlich beim ersten Mal ein bisschen erschrocken, aber erhat nie was gesagt. Bis heute ist es so, dass einem erst einmal die Knochenvorgestellt werden, wenn man eine Hütte betritt. Das ist mein Onkel, dasist mein Großvater usw. Das ist Teil der Kultur und hat nichts mitReligion zu tun. Jahre später, als jemand gestorben war, bauten die Fayuplötzlich eine sehr hohe Plattform und legten den Körper drauf. Undmein Vater fragte: „Was macht ihr denn, tut ihr das nicht in eureHütte?“ „Aber nein“, sagten sie ,“das stinkt dochzu sehr“. Das Ritual änderte sich von ganz allein, auch ohneEinmischung von außen.
Warum sind Sie mit 17nach Europa zurückgekehrt?
Aus verschiedenenGründen. Ein Grund war, dass ich plötzlich merkte, dass ichweiß war. Obwohl ich vom Herzen her sehr angenommen war vom Stamm, wurdemir plötzlich bewusst, dass ein Teil von mir doch nicht dazu gehörte.Und dann kam ich auch in ein Alter, wo man anfängt darübernachzudenken, wer man ist und wohin man gehört. Ich wollte sozusagen denStamm meiner Eltern kennen lernen. Ich war auch in einem Alter, wo ich anfing,über Beziehungen nachzudenken. Die fayu waren alle wie Brüderfür mich und ich konnte mir nicht vorstellen, einen Fayu zu heiraten.Heute könnte ich das, aber damals mit 17 noch nicht. Und dann wurde ichimmer unglücklicher. Und ich fing einfach an, mir Gedanken zu machen, wasich mit meinem Leben anfangen sollte.
Wie schwer war dieEingewöhnung in die Zivilisation?
Di ersten eineinhalb Jahreim Internat waren sehr schön, die habe ich sehr genossen, das hat mir vielSpaß gemacht und mein Plan war ja eigentlich, danach wiederzurückzukehren, doch ich wurde schwanger. Und als ich aus dem Internatherauskam, da habe ich einen richtigen Schock bekommen. Ich war nicht mehr ineiner geschützten Umgebung, ich war nicht mehr mit Mädchen aus allerWelt zusammen, die Kulturen verstanden, die tolerant waren. Ich wurde mit einerWelt konfrontiert, die meiner Ansicht nach kein Erbarmen, keine Toleranzkannte. Schwarze Menschen wurden schlecht behandelt, Frauen mit Kopftuch wurdenausgeschlossen. Das war für mich einfach so schockierend. Und ich war ineiner Situation, wo ich nicht mehr wusste, wer ist mein Feind, wer ist meinFreund.
Sie habenschließlich eine Karriere gestartet, haben sich nicht unterkriegen lassenvon der Zivilisation. Hat das Leben im Dschungel Sie besonders stark gemacht?
Ich frage mich das selbstmanchmal. Ich glaube, was mich stark gemacht hat, war mein Elternhaus, meinFamilienleben. Und ich glaube, dass ich im Urwald gelernt habe, dankbar zusein. Ich weiß nicht, ob die Deutschen realisieren, wie gut sie eseigentlich hier haben. Viele kritisieren an der Zivilisation, dass wir zu vielTechnologie haben, aber nicht dieTechnologie ist das Problem, sondern die Mentalität der Menschen, dieIntoleranz und die Kritik. Ich kannte zum Beispiel keinen Neid, bis ich hierherkam.
Ich habe gehört,dass Sie zurückkehren wollen, um einen Dokumentarfilm zu drehen...
Ich möchte erstmalzurückkehren, um die Leute zu sehen und habe dann überlegt, ob icheine Kamera mitnehme, um das live aufzunehmen. Nicht als herkömmlicherDokumentarfilm, sondern um aufzunehmen, wie das ist, wenn man nach so vielenJahren in den Urwald zurückkehrt.
Ist es vielleicht eineGefahr, wenn man die Menschen dort der Öffentlichkeit so zugänglichmacht?
Erstens lebt der Stamm ineinem Gebiet, wo kein Tourist hinkommt. Zweitens glaube ich nicht, dass Wissenetwas kaputt macht. Ich glaube, es ist das Unwissen, das Dinge zerstört.Wer die Menschen hier sieht und die Natur, der wird alles besser verstehen undsorgfältiger damit umgehen. Jährlich reisen tausende von Touristen inLändern ohne sich über die Kultur zu erkundigen und darüber, wasman machen darf und was nicht. Ohne nachzudenken legen sie sich nackt an dieStrände und behandeln die Menschen wie zweiter Klasse. Und ich glaubenicht, dass sie das absichtlich tun, ich glaube, es wird einfach aus Unwissengemacht.
Sie beschreiben, dass Siein einer Art Identitätskrise stecken und nicht wirklich hier und auchnicht dorthin gehören. Hat Ihnen das Schreiben des Buchs geholfen dieseKrise zu überwinden? Wie wird es sein in den Dschungelzurückzukehren?
Das Buch hat mir sehr, sehrgeholfen. Ich würde auch jedem, der eine Krise durchmacht, vorschlagen,einfach mal über sein Leben zu schreiben. Es ist erstaunlich, man bekommtmehr Distanz dazu und dann fallen einem auch noch so viele Sachen ein,über die man sonst nie nachgedacht hätte.
Ich hoffe, dass ich durchdie Rückkehr endlich einen Abschluss finden kann, wenn ich das alles nocheinmal sehe. Es ist wichtig für mich zur Ruhe zu kommen und irgendwiezwischen den beiden Welten zu leben und dort auch glücklich zu sein.
Die Fragenstellte Nicole Brunner / lorenzspringer medien
- Autor: Sabine Kuegler
- 2006, 30. Auflage, 352 Seiten, 24 farbige Abbildungen, mit zahlreichen Abbildungen, Maße: 12,5 x 19 cm, Taschenbuch, Deutsch
- Verlag: Droemer/Knaur
- ISBN-10: 3426778734
- ISBN-13: 9783426778739
- Erscheinungsdatum: 08.02.2024





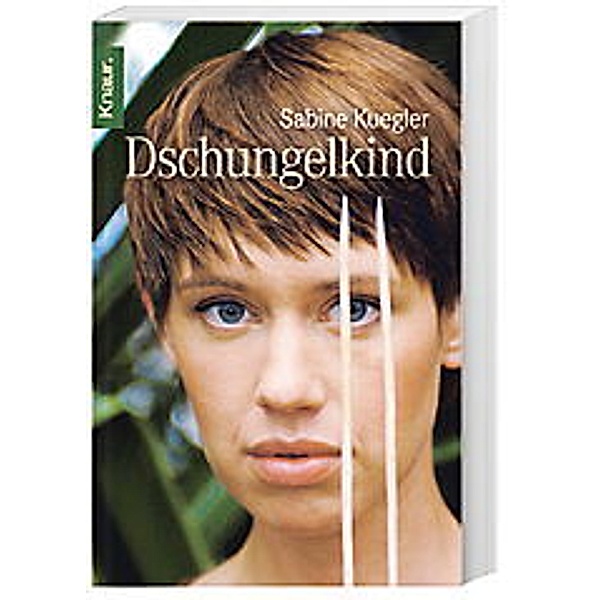

4.5 von 5 Sternen
5 Sterne 9Schreiben Sie einen Kommentar zu "Dschungelkind".
Kommentar verfassen