Das Haupt der Welt / Otto der Große Bd.1
Historischer Roman
Rebecca Gablé hat die Gabe, Menschen für längst vergangene Zeiten zu begeistern.
Brandenburg 929:
Beim Sturm durch das deutsche Heer unter König Heinrich I. wird der slawische Fürstensohn Tugomir gefangen...
Brandenburg 929:
Beim Sturm durch das deutsche Heer unter König Heinrich I. wird der slawische Fürstensohn Tugomir gefangen...
lieferbar
versandkostenfrei
Buch (Gebunden)
26.80 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Das Haupt der Welt / Otto der Große Bd.1 “
Rebecca Gablé hat die Gabe, Menschen für längst vergangene Zeiten zu begeistern.
Brandenburg 929:
Beim Sturm durch das deutsche Heer unter König Heinrich I. wird der slawische Fürstensohn Tugomir gefangen genommen und nach Magdeburg verschleppt. Schon bald macht er sich einen Namen als Heiler. Er rettet Heinrichs Sohn Otto das Leben und wird dessen Leibarzt und Lehrer seiner Söhne. Doch als nach Ottos Krönung die Widersacher den König stürzen wollen, wendet sich dieser mit einer ungewöhnlichen Bitte an Tugomir.
Lese-Probe zu „Das Haupt der Welt / Otto der Große Bd.1 “
Das Haupt der Welt von Rebecca GabléBrandenburg, Januar 929
... mehr
»Gib deinen Sachsen heraus, Tugomir«, befahl Bolilut.
»Heute ist er endlich fällig.«
»Ich habe keine Ahnung, wo er ist«, erwiderte Tugomir und fuhr fort, Haselwurzblätter in einen Mörser zu zählen. Bei dieser Aufgabe war äußerste Sorgfalt geboten, wenn er nicht die gesamte Priesterschaft vergiften wollte, und außerdem war es ihm lieber, seinen Bruder jetzt nicht anzuschauen.
Bolilut kam einen Schritt näher in den Lichtkreis der beiden Öllampen, die das Halbdunkel des Tempels zurückdrängten.
»Jetzt hab dich nicht so. Was kann dir ein blinder Sklave schon bedeuten? «
»Gar nichts«, log Tugomir. Sorgsam verschloss er die tönerne Vorratsschale mit ihrem dicht sitzenden Holzdeckel und stellte sie neben seinem Schemel auf den Boden. Dann griff er nach dem Pistill und begann, die getrockneten Blätter im Mörser zu zerreiben.
»Aber er darf diesen Tempel nicht betreten, wie du vermutlich weißt, darum wirst du ihn kaum hier finden.«
Sein älterer Bruder stieß die Luft durch die Nase aus; es war ein Laut voller Hohn. »Wo du ihn auch versteckt haben magst, es wird dir nichts nützen. Er wurde für Jarovit ausgewählt, und auf die Art kann er sich endlich mal nützlich machen.«
Tugomir arbeitete weiter. Die Blätter waren trocken, aber zäh und ledrig. Es war schwierig, sie zu dem feinen Pulver zu zerstoßen, das nötig war. »Lass mich das hier eben erledigen«, sagte er scheinbar gleichmütig. »Dann mache ich mich auf die Suche. Er kann uns schwerlich davonlaufen, nicht wahr? Keine Maus kommt aus dieser Burg heraus.«
»Oder hinein«, fügte Bolilut hinzu.
»Ich würde sagen, das bleibt abzuwarten«, entgegnete der Jüngere.
»Was soll das heißen? Du willst doch nicht im Ernst behaupten, du hättest Angst vor diesen halb erfrorenen Strohköpfen da draußen?«
Tugomir hob endlich den Kopf. »Geh hinaus auf den Wall und sieh sie dir an, Bolilut. Es sind Hunderte. Vor zwei Monaten sind sie hergekommen, und seit die Havel zugefroren ist, lagern sie auf dem verdammten Fluss. Sie schießen unsere Wachen vom Wehrgang und stecken unsere Palisaden in Brand. Seit sie da draußen liegen, ist kein Bote mehr durchgekommen, geschweige denn Proviant. Sie schlafen niemals, und sie scheinen immer noch genug zu essen zu haben, während wir hungern. Sie haben all ihre Nachbarn im Westen und Süden unterworfen, weil sie eben stärker sind und mehr Kriegsglück besitzen. Und jetzt haben sie ihren gierigen Blick nach Osten gerichtet und die Elbe überschritten, um uns ebenfalls zu unterwerfen. Trotzdem machen sie mir keine Angst, denn auch wir sind stark. Aber wie steht es mit unserem Kriegsglück? «
Bolilut betrachtete ihn voller Argwohn, beinah lauernd. »Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Nein?«
»Unser Kriegsglück wird zurückkehren, wenn wir Jarovit mit einem Opfer versöhnen. Das solltest du besser wissen als ich. Und das Los ist nun mal auf deinen Sachsen gefallen.«
Tugomir nickte langsam. »Das ist es, was mir Sorgen macht. Wir stehen dem mächtigsten Feind gegenüber, mit dem wir es je zu tun hatten, und alles, was wir Jarovit für seinen Beistand bieten, ist ein blinder Sklave?«
Bolilut zuckte unbekümmert die Achseln. »Du meinst, ein Fürstensohn und Tempelpriester würde den Göttern eher zusagen? Nur zu, Bruder, Freiwillige vor. Ich würde dir bestimmt keine Träne nachweinen. Und davon abgesehen ...«
Ein kunstvoll geschnitzter Eschenstock landete unsanft auf Boliluts Schulter. »Was sind das für frevlerische Reden?«, schalt eine altersraue Stimme. »Wann wirst du lernen, den Göttern Respekt zu erweisen, du junger Taugenichts?«
Tugomir erhob sich von seinem Schemel, und die ungleichen Brüder verneigten sich.
»Vergib mir noch dies eine Mal, Schedrag«, bat Bolilut augenzwinkernd und klopfte seinem Bruder jovial auf den Rücken, um zu vertuschen, dass das plötzliche Auftauchen des Hohepriesters ihn einschüchterte. Bolilut war sechsundzwanzig - acht Jahre älter als Tugomir -, hatte einen Sohn von seiner Frau, mindestens fünf von seinen Sklavinnen, und die Götter allein mochten wissen, wie viele Töchter. Er war ein wilder Geselle und großer Krieger und wartete mit unzureichend verhohlener Ungeduld darauf, dass ihr Vater endlich starb und den Fürstenthron für ihn räumte - aber vor dem Hohepriester fürchtete er sich.
Das amüsierte Tugomir ebenso, wie es ihn mit Befriedigung erfüllte. Seit jeher war es Tradition in ihrer Familie, dass der jüngere Sohn Priester im Tempel des mächtigen Jarovit wurde. Diese Rolle war Tugomir zugefallen, und manchmal bewahrte die Würde, die damit einherging, ihn vor Boliluts brüderlichen Heimsuchungen. »Das Los bestimmen die Götter«, belehrte Schedrag sie streng.
»Sie suchen sich ihr Opfer selber aus, und wir werden ihre Ratschlüsse nicht in Zweifel ziehen, ist das klar?«
»Gewiss, Schedrag«, antwortete Bolilut - es klang geradezu kleinlaut.
Tugomir nickte schweigend. Wie allen jungen Priestern war es ihm während des letzten Jahres seiner Ausbildung verboten, das Wort an den Hohepriester zu richten. Denn der Schüler musste das Gefäß werden, in welches der Meister alles Wissen, alle Zaubersprüche und Geschichten eingab, die auf diese Weise von einer Generation an die nächste überliefert wurden. Erst wenn der Schüler alle Fragen gestellt, all seine Zweifel und seine Unrast hinter sich gelassen hatte, durfte er sein Jahr des Schweigens beginnen, und nicht viele waren mit so jungen Jahren wie Tugomir dafür bereit. Sein Vater hatte einen Bullen geschlachtet und ein Fest zu Tugomirs Ehren gegeben, als Schedrag ihm mitgeteilt hatte, der junge Mann sei so weit. Und Bolilut hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Bruder einen Ledersack über den Kopf zu ziehen und ihn in die Kellergrube unter der Halle zu sperren, als alle zu betrunken waren, um es zu merken, denn Bolilut schätzte es nicht sonderlich, wenn nicht er derjenige war, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand ...
»Also dann.« Der Hohepriester vollführte eine ungeduldige Geste mit seinem Stock. Er war ein uralter, nahezu zahnloser Mann, auf dessen Haupt kein einziges Haar mehr wuchs, dafür aber üppige Büschel in den Ohren. Er wirkte runzelig und geschrumpft wie eine Dörrpflaume. Dieser offensichtliche körperliche Verfall tat seiner Würde aber seltsamerweise keinen Abbruch.
Tugomir hatte lange darüber nachgedacht, warum das so war, und war zu dem Schluss gekommen, es müsse an den Augen liegen. Diese waren dunkel und wirkten so scharf wie eh und je; sie waren wie Spiegel der großen Weisheit und Willensstärke des Hohepriesters. Und wie üblich war ihr Blick auch jetzt unerbittlich, als Schedrag Tugomir aufforderte: »Geh, hol den blinden Sklaven und übergib ihn den Männern deines Bruders. Es gibt noch viel zu tun vor der Zeremonie. Also spute dich und komm schnell zurück, damit ich nicht glauben muss, du wolltest dich vor deinen Pflichten drücken.«
Tugomir ahnte, wo er das vermutlich noch ahnungslose Opfer finden würde. Er verließ den Tempel und überquerte den Innenhof der oberen Burg. Der Schnee lag fast eine Elle hoch, aber die vielen Menschen, die hier lebten, hatten Wege hindurchgebahnt. Wohnhütten und Speicherhäuser standen dicht an dicht, zogen sich in einem weiten Rund den Wall entlang, und ihre flachen Dächer bildeten den Wehrgang. Oben an der Brustwehr standen die Krieger seines Vaters aufgereiht, Pfeile und Bögen griffbereit. Schweigend blickten sie auf die Havel hinab und behielten die Belagerer im Auge, die sich heute indes ruhig zu verhalten schienen.
Die übrigen Bewohner hatten sich in die Halle oder die umliegenden Holzhäuschen verkrochen, nahm Tugomir an, denn seit es am Morgen aufgehört hatte zu schneien, war es merklich kälter geworden, und ein schneidender Wind fegte über den Burghügel. Aus dem Speicherhaus zur Linken kam eine alte Sklavin, einen Tonteller mit einem Stapel getrockneter Brotfladen in der Hand. Sie hatte sich in ein abgeschabtes Fell gewickelt, stemmte sich gegen den eisigen Ostwind und lief, so schnell sie konnte, denn vermutlich schmerzten ihr die bloßen Füße von der Kälte.
Tugomir folgte ihr wesentlich langsamer zur großen Halle, die dem Tempel genau gegenüber auf der Ostseite des Burghofs stand. Er ertappte sich dabei, dass seine Schritte immer schleppender wurden. So sehr graute ihm vor dem, was er tun musste, dass er ein unangenehmes Ziehen hinter dem Brustbein verspürte. Was bei allen Göttern soll ich zu ihm sagen?
Der große Hauptraum der Halle, der zwanzig Schritt lang und etwa halb so breit war, wurde von den beiden langen Tischen beherrscht, an denen die Bewohner die Mahlzeiten einnahmen.
Auch hier war es still. Zwei dienstfreie Wachen hatten sich nahe der Wand in ihre Fellmäntel gewickelt auf den sandbedeckten Dielenboden gelegt und schliefen. Am prasselnden Feuer gleich hinter den Plätzen der Fürstenfamilie entdeckte Tugomir seine Schwester am Webstuhl, und zu ihren Füßen seinen blinden Freund.
»Dragomira? Weißt du, wo Vater ist?«
Sie sah von ihrer Arbeit auf. »Er ist in die Vorburg hinuntergegangen, um mit den Leuten dort zu reden. Sie fürchten sich. Der Schmied sagt, die Vorburg fällt immer zuerst.«
Da hat er recht, fuhr es Tugomir durch den Kopf. Er setzte sich neben sie auf die schmale Bank, mit dem Rücken zum Webstuhl. »Der Schmied sollte gut auf seine Zunge achtgeben«, bemerkte er. »Wenn er unseren Fall herbeiredet, könnte Vater sich entschließen, ihn von ihr zu befreien.«
»Zweifellos der klügste Weg, um unbequemen Wahrheiten zu begegnen«, murmelte Anno, der blinde Sklave vor sich hin, der mit angewinkelten Beinen am Boden saß, den linken Arm um die Knie gelegt.
Tugomir tauschte ein verstohlenes, schuldbewusstes Lächeln mit seiner Schwester. Dragomira mochte den unverschämten Sachsen genauso gern wie er, und seit Tugomir das Gefäß des Hohepriesters geworden war und nahezu all seine Zeit im Tempel zubrachte, sah man Anno ständig an Dragomiras Seite. Es machte nichts. Man konnte sie bedenkenlos mit ihm allein lassen, denn das Augenlicht war nicht das Einzige, was Bolilut Anno genommen hatte. Der Sachse war ein Krieger gewesen, und sein verdammter König Heinrich - derselbe König Heinrich, der jetzt seit zwei Monaten draußen vor der Burg kampierte und versuchte, sie einzunehmen - hatte Anno als Spion hergeschickt, um alles über Tugomirs Vater, seine Krieger und das Volk der Heveller auszukundschaften.
Aber Bolilut hatte ihn erwischt. Und teuer bezahlen lassen, denn nichts anderes verstanden diese sächsischen Hunde.
All das war lange her - Tugomir war in seinem zehnten Sommer gewesen, Dragomira im sechsten, und ihre Mutter war kurz zuvor gestorben. Obwohl der Verlust ihre Herzen bitter gemacht hatte und obwohl Tugomir und Dragomira natürlich alle Sachsen hassten, hatte ausgerechnet Anno, der wundersamerweise ihre Sprache verstand, ihnen Trost zu spenden vermocht.
Tugomir sah auf ihn hinab und zwang sich zu sagen: »Eigentlich war ich auf der Suche nach dir.«
Der Sklave wandte ihm das Gesicht zu. Er trug Dragomira zuliebe immer eine Stoffbinde über den grässlich vernarbten Augenhöhlen.
»Tatsächlich? Und wieso habe ich das Gefühl, dass die Ehre deiner Aufmerksamkeit mir wenig Freude bereiten wird?«
Tugomir biss sich auf die Unterlippe. Anno hörte einfach alles, was er nicht sehen konnte. »Wie kommst du darauf?«, fragte der junge Priester, um Zeit zu gewinnen.
»Weil deine Stimme nicht mehr so gebebt hat seit dem Tag vor zwei Jahren, als dein Vater sich in den Kopf gesetzt hatte, deine Schwester mit einem Obodritenprinzen zu verheiraten.«
Dragomira schnaubte angewidert. Die Obodriten waren die Todfeinde der Heveller. Doch zum Glück war die versöhnliche Anwandlung ihres Vaters, der sie beinah geopfert worden wäre, die alle verstört und Bolilut an den Rand der Rebellion getrieben hatte, schnell vorübergegangen.
»Darum nehme ich an, es handelt sich um etwas Unerfreuliches «, schloss Anno.
Tugomir schluckte. Sein Mund war ganz trocken. »Ja.«
»Dann raus damit.«
»Ich glaube, ich würde lieber allein mir dir darüber sprechen.«
»Unter zwei Augen sozusagen«, murmelte der Sachse vor sich hin. Dann dachte er einen Moment nach und schüttelte schließlich den Kopf. »Tugomir, ich weiß, dass ihr eure Frauen nur unwesentlich besser behandelt als eure Sklaven und eure Gäule weitaus mehr liebt als sie, aber sogar du solltest einsehen, dass es deiner Schwester auffallen wird, wenn ich plötzlich verschwunden bin.«
»Was?«, fragte Dragomira entgeistert. »Wovon redest du?«
»Tugomir?«, hakte Anno nach, seine Stimme mit einem Mal scharf.
Der junge Priester nahm sich zusammen. Einen Augenblick zögerte er, dann legte er dem Blinden die Hand auf die Schulter.
»Ja, es ist wahr, Anno. Jarovit verlangt ein Opfer. Und das Los ist auf dich gefallen. Es tut mir leid.« Dragomira stieß einen kleinen Schreckenslaut aus und sah zu ihrem Bruder.
Ohne Hast hob Anno die Linke und fegte die Hand von seiner Schulter. Dann stand er auf. »Und deswegen bist du so niedergeschlagen? Glaubst du denn wirklich, es gäbe irgendetwas an diesem Dasein, das ich nicht gern zurückließe?«
»Ihr habt nach mir geschickt, Vater?«
König Heinrich wandte den Kopf. »Komm rein, mein Junge.«
Prinz Otto betrat das Zelt. Sobald das Bärenfell, welches als Tür diente, hinter ihm zurück vor die Öffnung glitt, war der mörderische Wind abgeschnitten, aber trotzdem herrschte auch hier im Innern eisige Kälte. Die Felle, die den Boden bedeckten, lagen direkt auf dem Eis der Havel, und nur eine einzige Kohlepfanne stand auf einem Schemel neben der Pritsche. Das Glimmen der Holzkohle erweckte den Anschein von Behaglichkeit, aber Otto spürte keinen Hauch von Wärme.
Er zog den bibergefütterten Mantel fester um sich. »Wo sind Thietmar und Gero?« Otto hatte angenommen, dass die beiden Kommandanten, die das Reiterheer und die Fußsoldaten befehligten, bei der Lagebesprechung zugegen sein würden.
»Sie kommen gleich«, sagte der König und reichte seinem Sohn einen dampfenden Becher. »Wir werden heute Nacht stürmen, Otto. Das hier muss ein Ende nehmen. Wir verlieren zu viele Männer in dieser gottverfluchten Kälte.«
»Ich weiß.« Otto sog den Dampf ein, der seinem Becher entstieg, und trank vorsichtig einen Schluck. Es war heißer Würzwein, und er schmeckte himmlisch. »Aber vorgestern habt Ihr gesagt, die Verteidigung sei zu stark. Was hat sich geändert?«
Der König ging vor seiner Pritsche auf und ab. Das Zelt bot eigentlich nicht genug Platz dafür, aber Heinrich war ein rastloser Mann - immer gern in Bewegung. Otto schätzte die Jahre seines Vaters auf Anfang fünfzig, ein Alter also, da andere Männer sich allmählich einen Platz am Herd suchten und Jüngeren den Krieg überließen. Doch Heinrich war noch nicht müde - im Gegenteil. Von stämmiger, breitschultriger Statur, wirkte er so hart, als sei er aus Granit gemeißelt. Der kurze Bart war silbrig, das Haupthaar hingegen so rötlich blond wie eh und je.
Statt auf die Frage einzugehen, forderte er seinen Sohn auf: »Erinnere mich noch einmal, warum wir hier sind.«
Otto musste grinsen, antwortete aber: »Um diesen heidnischen Slawen hier den rechten Glauben zu bringen.«
Heinrich nickte. »Ein guter Grund, aber nicht der wahre.«
»Um unsere Ostgrenze zu sichern, die sie ständig mit ihren Raubzügen verletzen?«
»Noch ein guter Grund, aber auch nicht der wahre.«
»Dann um sie dafür zu bestrafen, dass sie die Ungarn gegen uns zu Hilfe geholt haben?«
Der König brummte wie ein Bär. Es klang gefährlich. »Ja, das werden sie noch bitter bereuen. Aber auch nicht der wahre Grund.«
Otto zuckte die Schultern. »Dann nennt Ihr ihn mir.«
»Es gibt drei: Erstens, um uns die slawischen Völker zu unterwerfen und tributpflichtig zu machen, denn wir müssen den Ungarn jedes Jahr Unsummen bezahlen, damit sie den vereinbarten neunjährigen Frieden halten. Zweitens, um ihre Pferde zu erbeuten, denn die Slawen züchten großartige Pferde, die wir für unsere neuen Panzerreiter brauchen. Und drittens, um eben diese Panzerreiter zu erproben. Damit wir wissen, wo wir stehen, bevor die Ungarn wiederkommen.«
Otto nickte und sagte nichts.
»Was?«, schnauzte der König.
»Gar nichts. Ich sehe ein, dass Ihr recht habt. Aber wohl ist mir nicht dabei.«
»Wieso nicht?«
»Ich glaube, wegen Eurer Prioritäten. Mir wäre lieber, Ihr hättet gesagt, die Bekehrung der Heiden sei der wichtigste Grund für diesen Feldzug.«
Heinrich hob einen seiner kurzen, breiten Finger und wedelte seinem Sohn damit vor der Nase herum. »Aber leider sind die noblen Gründe nur selten die wahren. Du musst die Welt so sehen, wie sie ist, Otto, sonst wirst du einen lausigen Herrscher abgeben. Du musst dich ihr stellen, auch wenn sie dir ihr hässliches Gesicht zeigt.«
»Aber muss ein Herrscher nicht das Ziel verfolgen, die Welt besser zu machen?«, wandte der Prinz ein.
Der König sah ihn an, stierte ihm regelrecht ins Gesicht, so lange, dass Otto unbehaglich wurde. Unvermittelt knackte das Eis unter ihren Füßen, und der Prinz wäre um ein Haar zusammengezuckt. Er wusste selbst, dass die Eisdecke mindestens zwei Spann dick war und jedes Gewicht aushalten würde; trotzdem war der Gedanke ihm unheimlich, dass sie mitten auf dem Fluss lagerten.
Schließlich schüttelte Heinrich den Kopf. »Vielleicht. Aber vorher muss er die Welt sicher machen. Du bist ein Träumer, Otto. Und das gefällt mir nicht. Du willst immer von jedem das Beste glauben und verschließt die Augen davor, wie die Dinge wirklich sind. Das kann dich teuer zu stehen kommen. Also hör auf damit.«
»Aber ich meine doch nur ...«
»Großmut ist eine schöne Gabe«, fiel der König ihm ins Wort.
»Aber wenn sie nicht mit Strenge gepaart ist, macht sie dich schwach. Und darum will ich, dass du heute Nacht den Sturm auf die Vorburg anführst.«
Otto stockte beinah der Atem. »Ich? Ihr denkt ... Ihr traut mir das wirklich zu?«
»Warum denn nicht, zum Teufel«, knurrte Heinrich. »Du bist ein Mann von sechzehn Jahren und hast mindestens so viel Kampferfahrung wie ich in deinem Alter. Du kannst und du weißt alles, was du brauchst. Also geh und tu es.«
Der Prinz war so stolz, so glücklich über diesen Vertrauensbeweis, dass er sich nur mit Mühe davon abhielt, seinem Vater um den Hals zu fallen. Doch was er erwiderte, war: »Was ist mit Thankmar? Er wird enttäuscht sein.«
Der König nickte ungerührt. »Aber auch dein Bruder ist hier, um etwas zu lernen, und darum wird die Enttäuschung ihm letzten Endes zum Nutzen gereichen.«
Otto hatte Zweifel, dass diese Anschauung bei seinem Bruder großen Anklang finden würde. Thankmar war schon zweiundzwanzig und ein erfahrenerer Soldat als Otto. Und weil der König Thankmars Mutter ins Kloster abgeschoben hatte, um Ottos Mutter heiraten zu können, fühlte Thankmar sich immer schnell zurückgesetzt. Nicht selten zu Recht, wusste Otto. Und das machte ihm zu schaffen, denn er hatte seinen Bruder gern.
Doch er verbarg sein Unbehagen. »Was immer Ihr wünscht, Vater.«
Heinrich schenkte sich aus dem dampfenden Krug auf dem Tisch nach, als sich draußen Schritte näherten.
»Mein König?«, rief eine tiefe Stimme.
»Nur herein, Thietmar«, antwortete Heinrich.
Graf Thietmar von Merseburg und sein Sohn Gero - die beiden Kommandanten - betraten das Zelt, dicht gefolgt von zwei Wachen, die einen Gefangenen in der Mitte führten.
Thietmar, Heinrichs langjähriger Freund und Kampfgefährte, zeigte unfein mit dem Finger auf Otto. »Ah. Unser Prinzlein hat's schon gehört, wie dieses breite Grinsen mir verrät.«
Otto bemühte sich schleunigst um eine würdevollere Miene und fragte grantig: »Wie viele Hevellerköpfe soll ich Euch bringen, damit Ihr aufhört, ›Prinzlein‹ zu mir zu sagen?«
»Ich überleg's mir und geb dir Bescheid«, stellte Thietmar in Aussicht.
Unterdessen hatte Gero den Gefangenen am Ellbogen gepackt und mit einem gut platzierten Tritt vor dem König auf die Knie befördert.
»So, Freundchen. Jetzt wiederhol noch einmal, was du mir gesagt hast.«
Der Heveller war ein hagerer Mann in löchriger Lederkleidung. Als er den Kopf hob und der dunkle Schopf von seinem Gesicht zurückfiel, sah Otto, wie mager es war. Es wirkte krank. Für einen Lidschlag trafen sich ihre Blicke, dann schaute der Gefangene den König an, und seine Miene wurde ausdruckslos. »Weg hinein. Unter Wall. Tunnel. Ich kann dir zeigen«, sagte er.
König Heinrich hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und ließ den Mann nicht aus den Augen. »Woher kannst du unsere Sprache?«
»Na ja, so würd ich's nicht nennen«, schränkte Gero ein. »Man versteht ja kaum, was der Kerl sich zusammenstammelt, es ist ...«
Er verstummte auf einen Blick des Königs.
»Ich Kaufmann«, erklärte der Heveller. »Bringe Häute und Vliese bis Magdeburg.«
»Aber hier bist du zu Hause?«
»Ja.«
»Und warum willst du deine Freunde und Nachbarn und deinen Fürsten ans Messer liefern, he? Warum willst du uns hineinbringen?«
Der Kaufmann antwortete nicht sofort. Seine Wangenmuskeln schienen einen Augenblick wie versteinert, und der Hass in seinem Blick konnte einem den Atem verschlagen. Dann nahm er sich zusammen. »Nichts mehr essen«, erklärte er nüchtern.
»Nichts mehr Feuer machen. Fürst in Burg hat genug Essen, aber Volk in Vorburg Hunger. Gestern mein Sohn tot. Volk soll nicht weiter sterben für Stolz von Fürst.«
Schuldbewusst erkannte Otto, dass der Heveller ihm leidtat. Er wusste, es war genau diese Art unangebrachter Gefühle, die sein Vater ihm eben vorgeworfen hatte, und er setzte alles daran, sie abzuschütteln.
Der König hingegen betrachtete den Kaufmann mit unverhohlener Verachtung. »Und was verlangst du für deine Judasdienste?«
»He?«
»Was willst du haben? Silber? Vieh? Sklaven? Was?«
»Nur Leben. Und nicht verraten Heveller. Behalt dein Silber.«
Er hielt sich anscheinend nur mit Mühe davon ab, auf den Boden zu spucken.
Der König verscheuchte ihn mit einem schroffen Wink.
»Schafft ihn mir aus den Augen, eh mir übel wird. Thietmar, lass dir diesen Tunnel zeigen und schick einen Kundschafter hinein, aber er soll sich bloß nicht schnappen lassen. Dann geht und rüstet euch.« Er tippte seinem Sohn an die Brust. »Das gilt auch für dich. Wir greifen eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit an.«
Frauen war es verboten, den Tempel des Jarovit zu betreten. Aber Dragomira wusste sich zu helfen, denn wie alle Frauen der fürstlichen Familie kannte sie das Sehende Auge der Wolkengöttin. Der Tempel stand am westlichen Rand der Burganlage, umgeben von einem Ring aus Eichen. Es war ein hohes Holzgebäude, mindestens so groß wie die Halle ihres Vaters und weitaus kunstvoller verziert. Die Balken und Bretter der Außenfassade waren geschnitzt, mit Linien- und Rankenmustern und Abbildern der Götter bemalt. Jedes Mal, wenn Dragomira sie sah, flößten ihre abweisenden Gesichter ihr Unbehagen ein. Und natürlich ein schlechtes Gewissen, denn sie hatte hier nichts zu suchen.
Trotzdem schlich sie weiter zum achten Baum links des Tempeleingangs und kletterte ohne Mühe hinauf. Zu Mittsommer, wenn das große Jarovitfest gefeiert wurde, bot das Eichenlaub einen guten Sichtschutz. Jetzt im Winter konnte sie nur auf die rasch zunehmende Dunkelheit hoffen. Sie wusste, was ihr blühte, wenn man sie erwischte. Das Gesetz sagte, eine Frau, die sich Jarovit verbotenerweise näherte, solle ihm noch am selben Tag geopfert werden, es sei denn, einer der Priester spreche dagegen. Da hier immer mindestens einer der Priester der Bruder, Vetter, Onkel oder Vater der Übeltäterin war, hatte seit Menschengedenken keine ihrer Ahninnen ihre übergroße Neugier mit dem Leben bezahlt, und Dragomira wusste genau, dass sie sich auf Tugomir verlassen konnte. Aber das Gesetz sagte auch, dass die Schuldige in dem Fall, da sie nicht geopfert wurde, zwischen der zwölften und dreizehnten Eiche anzubinden und so lange mit Ruten zu schlagen sei, bis das Blut einen See um ihre Füße bildete. Nichts und niemand würde sie davor bewahren können, denn der Hohepriester würde darauf bestehen, ihr Bruder Bolilut auch und vermutlich sogar ihr Vater.
Also war sie lieber vorsichtig.
Auf dem vierten Ast begann sie, nach außen zu rutschen, und als er gefährlich dünn wurde, richtete sie sich langsam auf und hielt sich an dem parallel wachsenden Ast darüber fest, um ihr Gewicht besser zu verteilen. Seitwärts bewegte sie sich weiter auf die Tempelwand zu, langsam und konzentriert, Hand über Hand, Fuß über Fuß. Sie blickte nicht nach unten, achtete nur darauf, immer mit einer Hand fest zuzupacken, ehe sie sich weiterwagte. Endlich ertastete sie die raue Holzwand vor sich, und im letzten Licht erahnte sie das pausbackige Antlitz Dodolas. Einen Moment musste Dragomira um Mut ringen. Dann packte sie die Wolkengöttin bei den Ohren, stellte einen Fuß in ihren geöffneten Mund, um den verdächtig knarrenden Eichenast von ihrem Gewicht zu entlasten, und spähte mit dem linken Auge durch das rechte der Göttin.
Pechfackeln in mannshohen Eisenständern und Öllichter am Boden tauchten die Tempelhalle in warmes Licht. Die Männer waren bereits alle versammelt, standen oder saßen in kleinen Gruppen um das Standbild des Gottes, der ein riesiges Füllhorn im Arm hielt. Die jüngsten Priesterschüler gingen umher und schenkten den Kriegern von dem Trank ein, den Tugomir bereitet hatte. Dragomira wusste nicht genau, was alles in den Met gemischt wurde, um dessen berauschende Wirkung zu verstärken und so die Pforte zur Welt der Götter zu öffnen. Bolilut und sein Freund Bogdan schienen jedenfalls schon heillos betrunken zu sein. Und sie waren nicht die Einzigen. Auch ihr Vater, Fürst Vaclavic, und die Priester tranken so schnell sie konnten, denn es war Frevel, bei der Tempelzeremonie länger als zwingend notwendig nüchtern zu bleiben.
Sogar Boliluts achtjähriger Sohn Dragomir, der erst vor wenigen Wochen seinen ersten Haarschnitt und seinen endgültigen Namen erhalten hatte, hielt einen der Tonbecher in den kleinen Händen. Der rückwärtige Teil des Tempels war für gewöhnlich mit Wandschirmen abgetrennt, denn dort wohnten die Priester und verwahrten die magischen Feldzeichen und die Truhen mit den Schätzen des Burgherrn. Vor allem stand dort jedoch die größte Kostbarkeit des Tempels: Jarovits goldener Schild. Sechs kräftige Männer waren vonnöten, um ihn vor den Kriegerscharen der Heveller einherzutragen - der einzige Zweck, zu welchem der Schild je den Tempel verließ. Jetzt waren die Wandschirme indes beiseitegeschoben, und der Schild stand dort auf seinem eisernen Gestell.
Das fein ziselierte Gold funkelte satt im Fackelschein.
Die Männer im Tempel bildeten eine Gasse. Zwei Priester führten Anno in die Mitte und hielten vor dem Standbild des Gottes an, das gleichgültig über ihre Köpfe hinweg nach Osten starrte. Dragomira fand Annos Gesicht immer schwer zu deuten, weil er keine Augen hatte, und von hier oben konnte sie es auch nicht genau erkennen. Aber seine Miene schien ihr gefasst, seine Haltung entspannt. Seine Lippen bewegten sich - sie nahm an, er betete zu seinen Göttern -; ansonsten hielt er still und wartete.
Schedrag, die beiden anderen älteren Priester und Tugomir traten vor, bildeten einen Kreis um das Opfer, legten einander die Hände auf die Schultern und begannen sich zu wiegen und leise zu singen. Der Fürst und die Krieger lauschten ehrfurchtsvoll den gesungenen Gebeten, mit denen die Priester Jarovit anflehten, ihr Opfer gnädig anzunehmen. Als der getragene Gesang endete, war es mit einem Mal sehr still im Tempel. Selbst hier oben auf ihrem Lauerposten spürte Dragomira die gespannte Erwartung, die unter den Kriegern herrschte. Der Winter, die Entbehrungen und die ständige Bedrohung durch die Belagerung hatten die Männer grimmig gemacht, wusste sie, und das Gebräu in ihren Bechern stachelte sie weiter an. Sie wollten Blut sehen.
Schedrag löste sich von den anderen Priestern, trat zu Anno und legte ihm beide Hände auf den Kopf. Der Blinde fuhr fast unmerklich zusammen, sank dann aber unter dem sanften Druck der Hände bereitwillig auf die Knie. Die beiden anderen Priester nahmen seine Handgelenke, führten sie auf den Rücken und banden sie mit einem Lederriemen. Tugomir wandte sich ab, ging in den rückwärtigen Teil des Tempels, hob ein Messer mit einem kostbaren Bernsteingriff aus einer der Truhen und brachte es dem Hohepriester.
Sein Gesicht war ernst und konzentriert - nichts sonst. Niemand hätte erraten können, dass das Opfer, das da duldsam wie ein ahnungsloses Kälbchen zu seinen Füßen kniete, sein Freund war.
Dragomira begann sich gerade zu fragen, ob Tugomir vielleicht so berauscht war, dass er ganz und gar in die Götterwelt entrückt war, als Schedrag ihm das feine Messer zurückgab und mit einer Geste bedeutete, das Opfer zu vollziehen.
Dragomira biss sich hart auf die Zunge, um einen Laut des Schreckens zu unterdrücken.
Tugomir sah auf das Messer in seinen Händen. Lange, so kam es ihr vor. Dann hob er den Blick und schaute Schedrag an. Der uralte Priester nickte ihm ernst zu. »Ich weiß. Aber es muss sein. Deswegen haben die Götter ihn ausgewählt. Damit du es tun und dein Volk vor dem Untergang bewahren kannst. Der Einzige, für den es wirklich ein Opfer bedeutet.«
Dragomira spürte Tränen in den Augen brennen, hob für einen Moment den Kopf und fuhr sich mit dem linken Unterarm übers Gesicht. Es kam ihr vor, als laste ein Mühlstein auf ihrem Herzen, und endlich gestand sie sich ein, was sie schon lange geahnt hatte: Sie hasste Schedrag. Er war ein gerissener alter Wolf, der ihren Vater vollkommen beherrschte und ihren Bruder gestohlen hatte.
Und jetzt zwang er ihn, etwas so Grauenvolles zu tun. Etwas, das Tugomir sich vermutlich niemals vergeben konnte. Natürlich war ihr klar, dass es in Wirklichkeit Jarovit war, der all diese Dinge tat. Aber einen Gott zu hassen war verboten. Also blieb ihr nur der Hohepriester.
Tugomir zögerte immer noch.
»Wird's bald? Nun schlachte den blinden Kapaun endlich, du Jammerlappen«, lallte Bolilut, was ihm einen so unsanften Rippenstoß von ihrem Vater eintrug, dass er zur Seite kippte.
Tugomir schien ihn nicht gehört zu haben. Immer noch sah er Schedrag unverwandt an. Dann hielt er ihm das Messer kopfschüttelnd hin und öffnete die Lippen, um irgendetwas zu sagen.
Der Priester kam ihm zuvor: »Es ist deine letzte Prüfung, Tugomir. Ich weiß, sie ist die schwerste. Aber wenn du jetzt dein Schweigen brichst, war alles umsonst, was du auf dich genommen und was du gelernt hast.«
»Er hat recht, Tugomir«, sagte Anno. Die versammelten Krieger murmelten aufgebracht. Dragomira schloss, dass es sich für ein Opfer nicht gehörte, die Priester anzusprechen. Doch wie sie Anno kannte, war ihm das völlig gleich. Sie täuschte sich nicht: »Wirf nicht alles weg, was du sein wolltest, nur damit dieses Stück Dörrfleisch mir die Kehle durchschneidet «, fuhr er fort. »Mir ist es lieber, wenn du es tust, ehrlich. Komm schon. Und wenn du mir Respekt erweisen willst, dann lass mich nicht länger warten.«
Tugomir erwachte aus seiner Starre. Dragomira sah Tränen über seine Wangen laufen, als er hinter Anno trat, ihm die Linke auf die Stirn legte und den Hinterkopf gegen seinen Oberschenkel drückte. Dann setzte er ihm die scharfe Klinge an den Hals und schnitt ihm mit einer raschen, aber kontrollierten Bewegung die Kehle durch.
Ein Blutstrahl schoss aus der klaffenden Wunde und ertränkte zischend eine der Öllampen am Boden. Anno gab einen Laut von sich, der wie ein Seufzen klang, und sein Leib erschauderte, aber Tugomir hielt ihn weiter fest. Er hatte das kostbare Messer fallen lassen und dem Sterbenden die Rechte auf die Schulter gelegt.
Und so verharrte er, bis Annos Körper erschlaffte und der Blutstrom ein Rinnsal wurde.
Dragomira konnte nicht länger hinschauen. Es war nicht der Anblick des toten Freundes, den sie unerträglich fand, sondern das Gesicht ihres Bruders. Sie richtete sich auf und wandte den Kopf. Als sie das Feuer entdeckte, durchzuckte sie ein solcher Schreck, dass sie um ein Haar den Halt verloren hätte.
Die ganze Vorburg brannte lichterloh.
© 2013 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
»Gib deinen Sachsen heraus, Tugomir«, befahl Bolilut.
»Heute ist er endlich fällig.«
»Ich habe keine Ahnung, wo er ist«, erwiderte Tugomir und fuhr fort, Haselwurzblätter in einen Mörser zu zählen. Bei dieser Aufgabe war äußerste Sorgfalt geboten, wenn er nicht die gesamte Priesterschaft vergiften wollte, und außerdem war es ihm lieber, seinen Bruder jetzt nicht anzuschauen.
Bolilut kam einen Schritt näher in den Lichtkreis der beiden Öllampen, die das Halbdunkel des Tempels zurückdrängten.
»Jetzt hab dich nicht so. Was kann dir ein blinder Sklave schon bedeuten? «
»Gar nichts«, log Tugomir. Sorgsam verschloss er die tönerne Vorratsschale mit ihrem dicht sitzenden Holzdeckel und stellte sie neben seinem Schemel auf den Boden. Dann griff er nach dem Pistill und begann, die getrockneten Blätter im Mörser zu zerreiben.
»Aber er darf diesen Tempel nicht betreten, wie du vermutlich weißt, darum wirst du ihn kaum hier finden.«
Sein älterer Bruder stieß die Luft durch die Nase aus; es war ein Laut voller Hohn. »Wo du ihn auch versteckt haben magst, es wird dir nichts nützen. Er wurde für Jarovit ausgewählt, und auf die Art kann er sich endlich mal nützlich machen.«
Tugomir arbeitete weiter. Die Blätter waren trocken, aber zäh und ledrig. Es war schwierig, sie zu dem feinen Pulver zu zerstoßen, das nötig war. »Lass mich das hier eben erledigen«, sagte er scheinbar gleichmütig. »Dann mache ich mich auf die Suche. Er kann uns schwerlich davonlaufen, nicht wahr? Keine Maus kommt aus dieser Burg heraus.«
»Oder hinein«, fügte Bolilut hinzu.
»Ich würde sagen, das bleibt abzuwarten«, entgegnete der Jüngere.
»Was soll das heißen? Du willst doch nicht im Ernst behaupten, du hättest Angst vor diesen halb erfrorenen Strohköpfen da draußen?«
Tugomir hob endlich den Kopf. »Geh hinaus auf den Wall und sieh sie dir an, Bolilut. Es sind Hunderte. Vor zwei Monaten sind sie hergekommen, und seit die Havel zugefroren ist, lagern sie auf dem verdammten Fluss. Sie schießen unsere Wachen vom Wehrgang und stecken unsere Palisaden in Brand. Seit sie da draußen liegen, ist kein Bote mehr durchgekommen, geschweige denn Proviant. Sie schlafen niemals, und sie scheinen immer noch genug zu essen zu haben, während wir hungern. Sie haben all ihre Nachbarn im Westen und Süden unterworfen, weil sie eben stärker sind und mehr Kriegsglück besitzen. Und jetzt haben sie ihren gierigen Blick nach Osten gerichtet und die Elbe überschritten, um uns ebenfalls zu unterwerfen. Trotzdem machen sie mir keine Angst, denn auch wir sind stark. Aber wie steht es mit unserem Kriegsglück? «
Bolilut betrachtete ihn voller Argwohn, beinah lauernd. »Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Nein?«
»Unser Kriegsglück wird zurückkehren, wenn wir Jarovit mit einem Opfer versöhnen. Das solltest du besser wissen als ich. Und das Los ist nun mal auf deinen Sachsen gefallen.«
Tugomir nickte langsam. »Das ist es, was mir Sorgen macht. Wir stehen dem mächtigsten Feind gegenüber, mit dem wir es je zu tun hatten, und alles, was wir Jarovit für seinen Beistand bieten, ist ein blinder Sklave?«
Bolilut zuckte unbekümmert die Achseln. »Du meinst, ein Fürstensohn und Tempelpriester würde den Göttern eher zusagen? Nur zu, Bruder, Freiwillige vor. Ich würde dir bestimmt keine Träne nachweinen. Und davon abgesehen ...«
Ein kunstvoll geschnitzter Eschenstock landete unsanft auf Boliluts Schulter. »Was sind das für frevlerische Reden?«, schalt eine altersraue Stimme. »Wann wirst du lernen, den Göttern Respekt zu erweisen, du junger Taugenichts?«
Tugomir erhob sich von seinem Schemel, und die ungleichen Brüder verneigten sich.
»Vergib mir noch dies eine Mal, Schedrag«, bat Bolilut augenzwinkernd und klopfte seinem Bruder jovial auf den Rücken, um zu vertuschen, dass das plötzliche Auftauchen des Hohepriesters ihn einschüchterte. Bolilut war sechsundzwanzig - acht Jahre älter als Tugomir -, hatte einen Sohn von seiner Frau, mindestens fünf von seinen Sklavinnen, und die Götter allein mochten wissen, wie viele Töchter. Er war ein wilder Geselle und großer Krieger und wartete mit unzureichend verhohlener Ungeduld darauf, dass ihr Vater endlich starb und den Fürstenthron für ihn räumte - aber vor dem Hohepriester fürchtete er sich.
Das amüsierte Tugomir ebenso, wie es ihn mit Befriedigung erfüllte. Seit jeher war es Tradition in ihrer Familie, dass der jüngere Sohn Priester im Tempel des mächtigen Jarovit wurde. Diese Rolle war Tugomir zugefallen, und manchmal bewahrte die Würde, die damit einherging, ihn vor Boliluts brüderlichen Heimsuchungen. »Das Los bestimmen die Götter«, belehrte Schedrag sie streng.
»Sie suchen sich ihr Opfer selber aus, und wir werden ihre Ratschlüsse nicht in Zweifel ziehen, ist das klar?«
»Gewiss, Schedrag«, antwortete Bolilut - es klang geradezu kleinlaut.
Tugomir nickte schweigend. Wie allen jungen Priestern war es ihm während des letzten Jahres seiner Ausbildung verboten, das Wort an den Hohepriester zu richten. Denn der Schüler musste das Gefäß werden, in welches der Meister alles Wissen, alle Zaubersprüche und Geschichten eingab, die auf diese Weise von einer Generation an die nächste überliefert wurden. Erst wenn der Schüler alle Fragen gestellt, all seine Zweifel und seine Unrast hinter sich gelassen hatte, durfte er sein Jahr des Schweigens beginnen, und nicht viele waren mit so jungen Jahren wie Tugomir dafür bereit. Sein Vater hatte einen Bullen geschlachtet und ein Fest zu Tugomirs Ehren gegeben, als Schedrag ihm mitgeteilt hatte, der junge Mann sei so weit. Und Bolilut hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Bruder einen Ledersack über den Kopf zu ziehen und ihn in die Kellergrube unter der Halle zu sperren, als alle zu betrunken waren, um es zu merken, denn Bolilut schätzte es nicht sonderlich, wenn nicht er derjenige war, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand ...
»Also dann.« Der Hohepriester vollführte eine ungeduldige Geste mit seinem Stock. Er war ein uralter, nahezu zahnloser Mann, auf dessen Haupt kein einziges Haar mehr wuchs, dafür aber üppige Büschel in den Ohren. Er wirkte runzelig und geschrumpft wie eine Dörrpflaume. Dieser offensichtliche körperliche Verfall tat seiner Würde aber seltsamerweise keinen Abbruch.
Tugomir hatte lange darüber nachgedacht, warum das so war, und war zu dem Schluss gekommen, es müsse an den Augen liegen. Diese waren dunkel und wirkten so scharf wie eh und je; sie waren wie Spiegel der großen Weisheit und Willensstärke des Hohepriesters. Und wie üblich war ihr Blick auch jetzt unerbittlich, als Schedrag Tugomir aufforderte: »Geh, hol den blinden Sklaven und übergib ihn den Männern deines Bruders. Es gibt noch viel zu tun vor der Zeremonie. Also spute dich und komm schnell zurück, damit ich nicht glauben muss, du wolltest dich vor deinen Pflichten drücken.«
Tugomir ahnte, wo er das vermutlich noch ahnungslose Opfer finden würde. Er verließ den Tempel und überquerte den Innenhof der oberen Burg. Der Schnee lag fast eine Elle hoch, aber die vielen Menschen, die hier lebten, hatten Wege hindurchgebahnt. Wohnhütten und Speicherhäuser standen dicht an dicht, zogen sich in einem weiten Rund den Wall entlang, und ihre flachen Dächer bildeten den Wehrgang. Oben an der Brustwehr standen die Krieger seines Vaters aufgereiht, Pfeile und Bögen griffbereit. Schweigend blickten sie auf die Havel hinab und behielten die Belagerer im Auge, die sich heute indes ruhig zu verhalten schienen.
Die übrigen Bewohner hatten sich in die Halle oder die umliegenden Holzhäuschen verkrochen, nahm Tugomir an, denn seit es am Morgen aufgehört hatte zu schneien, war es merklich kälter geworden, und ein schneidender Wind fegte über den Burghügel. Aus dem Speicherhaus zur Linken kam eine alte Sklavin, einen Tonteller mit einem Stapel getrockneter Brotfladen in der Hand. Sie hatte sich in ein abgeschabtes Fell gewickelt, stemmte sich gegen den eisigen Ostwind und lief, so schnell sie konnte, denn vermutlich schmerzten ihr die bloßen Füße von der Kälte.
Tugomir folgte ihr wesentlich langsamer zur großen Halle, die dem Tempel genau gegenüber auf der Ostseite des Burghofs stand. Er ertappte sich dabei, dass seine Schritte immer schleppender wurden. So sehr graute ihm vor dem, was er tun musste, dass er ein unangenehmes Ziehen hinter dem Brustbein verspürte. Was bei allen Göttern soll ich zu ihm sagen?
Der große Hauptraum der Halle, der zwanzig Schritt lang und etwa halb so breit war, wurde von den beiden langen Tischen beherrscht, an denen die Bewohner die Mahlzeiten einnahmen.
Auch hier war es still. Zwei dienstfreie Wachen hatten sich nahe der Wand in ihre Fellmäntel gewickelt auf den sandbedeckten Dielenboden gelegt und schliefen. Am prasselnden Feuer gleich hinter den Plätzen der Fürstenfamilie entdeckte Tugomir seine Schwester am Webstuhl, und zu ihren Füßen seinen blinden Freund.
»Dragomira? Weißt du, wo Vater ist?«
Sie sah von ihrer Arbeit auf. »Er ist in die Vorburg hinuntergegangen, um mit den Leuten dort zu reden. Sie fürchten sich. Der Schmied sagt, die Vorburg fällt immer zuerst.«
Da hat er recht, fuhr es Tugomir durch den Kopf. Er setzte sich neben sie auf die schmale Bank, mit dem Rücken zum Webstuhl. »Der Schmied sollte gut auf seine Zunge achtgeben«, bemerkte er. »Wenn er unseren Fall herbeiredet, könnte Vater sich entschließen, ihn von ihr zu befreien.«
»Zweifellos der klügste Weg, um unbequemen Wahrheiten zu begegnen«, murmelte Anno, der blinde Sklave vor sich hin, der mit angewinkelten Beinen am Boden saß, den linken Arm um die Knie gelegt.
Tugomir tauschte ein verstohlenes, schuldbewusstes Lächeln mit seiner Schwester. Dragomira mochte den unverschämten Sachsen genauso gern wie er, und seit Tugomir das Gefäß des Hohepriesters geworden war und nahezu all seine Zeit im Tempel zubrachte, sah man Anno ständig an Dragomiras Seite. Es machte nichts. Man konnte sie bedenkenlos mit ihm allein lassen, denn das Augenlicht war nicht das Einzige, was Bolilut Anno genommen hatte. Der Sachse war ein Krieger gewesen, und sein verdammter König Heinrich - derselbe König Heinrich, der jetzt seit zwei Monaten draußen vor der Burg kampierte und versuchte, sie einzunehmen - hatte Anno als Spion hergeschickt, um alles über Tugomirs Vater, seine Krieger und das Volk der Heveller auszukundschaften.
Aber Bolilut hatte ihn erwischt. Und teuer bezahlen lassen, denn nichts anderes verstanden diese sächsischen Hunde.
All das war lange her - Tugomir war in seinem zehnten Sommer gewesen, Dragomira im sechsten, und ihre Mutter war kurz zuvor gestorben. Obwohl der Verlust ihre Herzen bitter gemacht hatte und obwohl Tugomir und Dragomira natürlich alle Sachsen hassten, hatte ausgerechnet Anno, der wundersamerweise ihre Sprache verstand, ihnen Trost zu spenden vermocht.
Tugomir sah auf ihn hinab und zwang sich zu sagen: »Eigentlich war ich auf der Suche nach dir.«
Der Sklave wandte ihm das Gesicht zu. Er trug Dragomira zuliebe immer eine Stoffbinde über den grässlich vernarbten Augenhöhlen.
»Tatsächlich? Und wieso habe ich das Gefühl, dass die Ehre deiner Aufmerksamkeit mir wenig Freude bereiten wird?«
Tugomir biss sich auf die Unterlippe. Anno hörte einfach alles, was er nicht sehen konnte. »Wie kommst du darauf?«, fragte der junge Priester, um Zeit zu gewinnen.
»Weil deine Stimme nicht mehr so gebebt hat seit dem Tag vor zwei Jahren, als dein Vater sich in den Kopf gesetzt hatte, deine Schwester mit einem Obodritenprinzen zu verheiraten.«
Dragomira schnaubte angewidert. Die Obodriten waren die Todfeinde der Heveller. Doch zum Glück war die versöhnliche Anwandlung ihres Vaters, der sie beinah geopfert worden wäre, die alle verstört und Bolilut an den Rand der Rebellion getrieben hatte, schnell vorübergegangen.
»Darum nehme ich an, es handelt sich um etwas Unerfreuliches «, schloss Anno.
Tugomir schluckte. Sein Mund war ganz trocken. »Ja.«
»Dann raus damit.«
»Ich glaube, ich würde lieber allein mir dir darüber sprechen.«
»Unter zwei Augen sozusagen«, murmelte der Sachse vor sich hin. Dann dachte er einen Moment nach und schüttelte schließlich den Kopf. »Tugomir, ich weiß, dass ihr eure Frauen nur unwesentlich besser behandelt als eure Sklaven und eure Gäule weitaus mehr liebt als sie, aber sogar du solltest einsehen, dass es deiner Schwester auffallen wird, wenn ich plötzlich verschwunden bin.«
»Was?«, fragte Dragomira entgeistert. »Wovon redest du?«
»Tugomir?«, hakte Anno nach, seine Stimme mit einem Mal scharf.
Der junge Priester nahm sich zusammen. Einen Augenblick zögerte er, dann legte er dem Blinden die Hand auf die Schulter.
»Ja, es ist wahr, Anno. Jarovit verlangt ein Opfer. Und das Los ist auf dich gefallen. Es tut mir leid.« Dragomira stieß einen kleinen Schreckenslaut aus und sah zu ihrem Bruder.
Ohne Hast hob Anno die Linke und fegte die Hand von seiner Schulter. Dann stand er auf. »Und deswegen bist du so niedergeschlagen? Glaubst du denn wirklich, es gäbe irgendetwas an diesem Dasein, das ich nicht gern zurückließe?«
»Ihr habt nach mir geschickt, Vater?«
König Heinrich wandte den Kopf. »Komm rein, mein Junge.«
Prinz Otto betrat das Zelt. Sobald das Bärenfell, welches als Tür diente, hinter ihm zurück vor die Öffnung glitt, war der mörderische Wind abgeschnitten, aber trotzdem herrschte auch hier im Innern eisige Kälte. Die Felle, die den Boden bedeckten, lagen direkt auf dem Eis der Havel, und nur eine einzige Kohlepfanne stand auf einem Schemel neben der Pritsche. Das Glimmen der Holzkohle erweckte den Anschein von Behaglichkeit, aber Otto spürte keinen Hauch von Wärme.
Er zog den bibergefütterten Mantel fester um sich. »Wo sind Thietmar und Gero?« Otto hatte angenommen, dass die beiden Kommandanten, die das Reiterheer und die Fußsoldaten befehligten, bei der Lagebesprechung zugegen sein würden.
»Sie kommen gleich«, sagte der König und reichte seinem Sohn einen dampfenden Becher. »Wir werden heute Nacht stürmen, Otto. Das hier muss ein Ende nehmen. Wir verlieren zu viele Männer in dieser gottverfluchten Kälte.«
»Ich weiß.« Otto sog den Dampf ein, der seinem Becher entstieg, und trank vorsichtig einen Schluck. Es war heißer Würzwein, und er schmeckte himmlisch. »Aber vorgestern habt Ihr gesagt, die Verteidigung sei zu stark. Was hat sich geändert?«
Der König ging vor seiner Pritsche auf und ab. Das Zelt bot eigentlich nicht genug Platz dafür, aber Heinrich war ein rastloser Mann - immer gern in Bewegung. Otto schätzte die Jahre seines Vaters auf Anfang fünfzig, ein Alter also, da andere Männer sich allmählich einen Platz am Herd suchten und Jüngeren den Krieg überließen. Doch Heinrich war noch nicht müde - im Gegenteil. Von stämmiger, breitschultriger Statur, wirkte er so hart, als sei er aus Granit gemeißelt. Der kurze Bart war silbrig, das Haupthaar hingegen so rötlich blond wie eh und je.
Statt auf die Frage einzugehen, forderte er seinen Sohn auf: »Erinnere mich noch einmal, warum wir hier sind.«
Otto musste grinsen, antwortete aber: »Um diesen heidnischen Slawen hier den rechten Glauben zu bringen.«
Heinrich nickte. »Ein guter Grund, aber nicht der wahre.«
»Um unsere Ostgrenze zu sichern, die sie ständig mit ihren Raubzügen verletzen?«
»Noch ein guter Grund, aber auch nicht der wahre.«
»Dann um sie dafür zu bestrafen, dass sie die Ungarn gegen uns zu Hilfe geholt haben?«
Der König brummte wie ein Bär. Es klang gefährlich. »Ja, das werden sie noch bitter bereuen. Aber auch nicht der wahre Grund.«
Otto zuckte die Schultern. »Dann nennt Ihr ihn mir.«
»Es gibt drei: Erstens, um uns die slawischen Völker zu unterwerfen und tributpflichtig zu machen, denn wir müssen den Ungarn jedes Jahr Unsummen bezahlen, damit sie den vereinbarten neunjährigen Frieden halten. Zweitens, um ihre Pferde zu erbeuten, denn die Slawen züchten großartige Pferde, die wir für unsere neuen Panzerreiter brauchen. Und drittens, um eben diese Panzerreiter zu erproben. Damit wir wissen, wo wir stehen, bevor die Ungarn wiederkommen.«
Otto nickte und sagte nichts.
»Was?«, schnauzte der König.
»Gar nichts. Ich sehe ein, dass Ihr recht habt. Aber wohl ist mir nicht dabei.«
»Wieso nicht?«
»Ich glaube, wegen Eurer Prioritäten. Mir wäre lieber, Ihr hättet gesagt, die Bekehrung der Heiden sei der wichtigste Grund für diesen Feldzug.«
Heinrich hob einen seiner kurzen, breiten Finger und wedelte seinem Sohn damit vor der Nase herum. »Aber leider sind die noblen Gründe nur selten die wahren. Du musst die Welt so sehen, wie sie ist, Otto, sonst wirst du einen lausigen Herrscher abgeben. Du musst dich ihr stellen, auch wenn sie dir ihr hässliches Gesicht zeigt.«
»Aber muss ein Herrscher nicht das Ziel verfolgen, die Welt besser zu machen?«, wandte der Prinz ein.
Der König sah ihn an, stierte ihm regelrecht ins Gesicht, so lange, dass Otto unbehaglich wurde. Unvermittelt knackte das Eis unter ihren Füßen, und der Prinz wäre um ein Haar zusammengezuckt. Er wusste selbst, dass die Eisdecke mindestens zwei Spann dick war und jedes Gewicht aushalten würde; trotzdem war der Gedanke ihm unheimlich, dass sie mitten auf dem Fluss lagerten.
Schließlich schüttelte Heinrich den Kopf. »Vielleicht. Aber vorher muss er die Welt sicher machen. Du bist ein Träumer, Otto. Und das gefällt mir nicht. Du willst immer von jedem das Beste glauben und verschließt die Augen davor, wie die Dinge wirklich sind. Das kann dich teuer zu stehen kommen. Also hör auf damit.«
»Aber ich meine doch nur ...«
»Großmut ist eine schöne Gabe«, fiel der König ihm ins Wort.
»Aber wenn sie nicht mit Strenge gepaart ist, macht sie dich schwach. Und darum will ich, dass du heute Nacht den Sturm auf die Vorburg anführst.«
Otto stockte beinah der Atem. »Ich? Ihr denkt ... Ihr traut mir das wirklich zu?«
»Warum denn nicht, zum Teufel«, knurrte Heinrich. »Du bist ein Mann von sechzehn Jahren und hast mindestens so viel Kampferfahrung wie ich in deinem Alter. Du kannst und du weißt alles, was du brauchst. Also geh und tu es.«
Der Prinz war so stolz, so glücklich über diesen Vertrauensbeweis, dass er sich nur mit Mühe davon abhielt, seinem Vater um den Hals zu fallen. Doch was er erwiderte, war: »Was ist mit Thankmar? Er wird enttäuscht sein.«
Der König nickte ungerührt. »Aber auch dein Bruder ist hier, um etwas zu lernen, und darum wird die Enttäuschung ihm letzten Endes zum Nutzen gereichen.«
Otto hatte Zweifel, dass diese Anschauung bei seinem Bruder großen Anklang finden würde. Thankmar war schon zweiundzwanzig und ein erfahrenerer Soldat als Otto. Und weil der König Thankmars Mutter ins Kloster abgeschoben hatte, um Ottos Mutter heiraten zu können, fühlte Thankmar sich immer schnell zurückgesetzt. Nicht selten zu Recht, wusste Otto. Und das machte ihm zu schaffen, denn er hatte seinen Bruder gern.
Doch er verbarg sein Unbehagen. »Was immer Ihr wünscht, Vater.«
Heinrich schenkte sich aus dem dampfenden Krug auf dem Tisch nach, als sich draußen Schritte näherten.
»Mein König?«, rief eine tiefe Stimme.
»Nur herein, Thietmar«, antwortete Heinrich.
Graf Thietmar von Merseburg und sein Sohn Gero - die beiden Kommandanten - betraten das Zelt, dicht gefolgt von zwei Wachen, die einen Gefangenen in der Mitte führten.
Thietmar, Heinrichs langjähriger Freund und Kampfgefährte, zeigte unfein mit dem Finger auf Otto. »Ah. Unser Prinzlein hat's schon gehört, wie dieses breite Grinsen mir verrät.«
Otto bemühte sich schleunigst um eine würdevollere Miene und fragte grantig: »Wie viele Hevellerköpfe soll ich Euch bringen, damit Ihr aufhört, ›Prinzlein‹ zu mir zu sagen?«
»Ich überleg's mir und geb dir Bescheid«, stellte Thietmar in Aussicht.
Unterdessen hatte Gero den Gefangenen am Ellbogen gepackt und mit einem gut platzierten Tritt vor dem König auf die Knie befördert.
»So, Freundchen. Jetzt wiederhol noch einmal, was du mir gesagt hast.«
Der Heveller war ein hagerer Mann in löchriger Lederkleidung. Als er den Kopf hob und der dunkle Schopf von seinem Gesicht zurückfiel, sah Otto, wie mager es war. Es wirkte krank. Für einen Lidschlag trafen sich ihre Blicke, dann schaute der Gefangene den König an, und seine Miene wurde ausdruckslos. »Weg hinein. Unter Wall. Tunnel. Ich kann dir zeigen«, sagte er.
König Heinrich hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und ließ den Mann nicht aus den Augen. »Woher kannst du unsere Sprache?«
»Na ja, so würd ich's nicht nennen«, schränkte Gero ein. »Man versteht ja kaum, was der Kerl sich zusammenstammelt, es ist ...«
Er verstummte auf einen Blick des Königs.
»Ich Kaufmann«, erklärte der Heveller. »Bringe Häute und Vliese bis Magdeburg.«
»Aber hier bist du zu Hause?«
»Ja.«
»Und warum willst du deine Freunde und Nachbarn und deinen Fürsten ans Messer liefern, he? Warum willst du uns hineinbringen?«
Der Kaufmann antwortete nicht sofort. Seine Wangenmuskeln schienen einen Augenblick wie versteinert, und der Hass in seinem Blick konnte einem den Atem verschlagen. Dann nahm er sich zusammen. »Nichts mehr essen«, erklärte er nüchtern.
»Nichts mehr Feuer machen. Fürst in Burg hat genug Essen, aber Volk in Vorburg Hunger. Gestern mein Sohn tot. Volk soll nicht weiter sterben für Stolz von Fürst.«
Schuldbewusst erkannte Otto, dass der Heveller ihm leidtat. Er wusste, es war genau diese Art unangebrachter Gefühle, die sein Vater ihm eben vorgeworfen hatte, und er setzte alles daran, sie abzuschütteln.
Der König hingegen betrachtete den Kaufmann mit unverhohlener Verachtung. »Und was verlangst du für deine Judasdienste?«
»He?«
»Was willst du haben? Silber? Vieh? Sklaven? Was?«
»Nur Leben. Und nicht verraten Heveller. Behalt dein Silber.«
Er hielt sich anscheinend nur mit Mühe davon ab, auf den Boden zu spucken.
Der König verscheuchte ihn mit einem schroffen Wink.
»Schafft ihn mir aus den Augen, eh mir übel wird. Thietmar, lass dir diesen Tunnel zeigen und schick einen Kundschafter hinein, aber er soll sich bloß nicht schnappen lassen. Dann geht und rüstet euch.« Er tippte seinem Sohn an die Brust. »Das gilt auch für dich. Wir greifen eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit an.«
Frauen war es verboten, den Tempel des Jarovit zu betreten. Aber Dragomira wusste sich zu helfen, denn wie alle Frauen der fürstlichen Familie kannte sie das Sehende Auge der Wolkengöttin. Der Tempel stand am westlichen Rand der Burganlage, umgeben von einem Ring aus Eichen. Es war ein hohes Holzgebäude, mindestens so groß wie die Halle ihres Vaters und weitaus kunstvoller verziert. Die Balken und Bretter der Außenfassade waren geschnitzt, mit Linien- und Rankenmustern und Abbildern der Götter bemalt. Jedes Mal, wenn Dragomira sie sah, flößten ihre abweisenden Gesichter ihr Unbehagen ein. Und natürlich ein schlechtes Gewissen, denn sie hatte hier nichts zu suchen.
Trotzdem schlich sie weiter zum achten Baum links des Tempeleingangs und kletterte ohne Mühe hinauf. Zu Mittsommer, wenn das große Jarovitfest gefeiert wurde, bot das Eichenlaub einen guten Sichtschutz. Jetzt im Winter konnte sie nur auf die rasch zunehmende Dunkelheit hoffen. Sie wusste, was ihr blühte, wenn man sie erwischte. Das Gesetz sagte, eine Frau, die sich Jarovit verbotenerweise näherte, solle ihm noch am selben Tag geopfert werden, es sei denn, einer der Priester spreche dagegen. Da hier immer mindestens einer der Priester der Bruder, Vetter, Onkel oder Vater der Übeltäterin war, hatte seit Menschengedenken keine ihrer Ahninnen ihre übergroße Neugier mit dem Leben bezahlt, und Dragomira wusste genau, dass sie sich auf Tugomir verlassen konnte. Aber das Gesetz sagte auch, dass die Schuldige in dem Fall, da sie nicht geopfert wurde, zwischen der zwölften und dreizehnten Eiche anzubinden und so lange mit Ruten zu schlagen sei, bis das Blut einen See um ihre Füße bildete. Nichts und niemand würde sie davor bewahren können, denn der Hohepriester würde darauf bestehen, ihr Bruder Bolilut auch und vermutlich sogar ihr Vater.
Also war sie lieber vorsichtig.
Auf dem vierten Ast begann sie, nach außen zu rutschen, und als er gefährlich dünn wurde, richtete sie sich langsam auf und hielt sich an dem parallel wachsenden Ast darüber fest, um ihr Gewicht besser zu verteilen. Seitwärts bewegte sie sich weiter auf die Tempelwand zu, langsam und konzentriert, Hand über Hand, Fuß über Fuß. Sie blickte nicht nach unten, achtete nur darauf, immer mit einer Hand fest zuzupacken, ehe sie sich weiterwagte. Endlich ertastete sie die raue Holzwand vor sich, und im letzten Licht erahnte sie das pausbackige Antlitz Dodolas. Einen Moment musste Dragomira um Mut ringen. Dann packte sie die Wolkengöttin bei den Ohren, stellte einen Fuß in ihren geöffneten Mund, um den verdächtig knarrenden Eichenast von ihrem Gewicht zu entlasten, und spähte mit dem linken Auge durch das rechte der Göttin.
Pechfackeln in mannshohen Eisenständern und Öllichter am Boden tauchten die Tempelhalle in warmes Licht. Die Männer waren bereits alle versammelt, standen oder saßen in kleinen Gruppen um das Standbild des Gottes, der ein riesiges Füllhorn im Arm hielt. Die jüngsten Priesterschüler gingen umher und schenkten den Kriegern von dem Trank ein, den Tugomir bereitet hatte. Dragomira wusste nicht genau, was alles in den Met gemischt wurde, um dessen berauschende Wirkung zu verstärken und so die Pforte zur Welt der Götter zu öffnen. Bolilut und sein Freund Bogdan schienen jedenfalls schon heillos betrunken zu sein. Und sie waren nicht die Einzigen. Auch ihr Vater, Fürst Vaclavic, und die Priester tranken so schnell sie konnten, denn es war Frevel, bei der Tempelzeremonie länger als zwingend notwendig nüchtern zu bleiben.
Sogar Boliluts achtjähriger Sohn Dragomir, der erst vor wenigen Wochen seinen ersten Haarschnitt und seinen endgültigen Namen erhalten hatte, hielt einen der Tonbecher in den kleinen Händen. Der rückwärtige Teil des Tempels war für gewöhnlich mit Wandschirmen abgetrennt, denn dort wohnten die Priester und verwahrten die magischen Feldzeichen und die Truhen mit den Schätzen des Burgherrn. Vor allem stand dort jedoch die größte Kostbarkeit des Tempels: Jarovits goldener Schild. Sechs kräftige Männer waren vonnöten, um ihn vor den Kriegerscharen der Heveller einherzutragen - der einzige Zweck, zu welchem der Schild je den Tempel verließ. Jetzt waren die Wandschirme indes beiseitegeschoben, und der Schild stand dort auf seinem eisernen Gestell.
Das fein ziselierte Gold funkelte satt im Fackelschein.
Die Männer im Tempel bildeten eine Gasse. Zwei Priester führten Anno in die Mitte und hielten vor dem Standbild des Gottes an, das gleichgültig über ihre Köpfe hinweg nach Osten starrte. Dragomira fand Annos Gesicht immer schwer zu deuten, weil er keine Augen hatte, und von hier oben konnte sie es auch nicht genau erkennen. Aber seine Miene schien ihr gefasst, seine Haltung entspannt. Seine Lippen bewegten sich - sie nahm an, er betete zu seinen Göttern -; ansonsten hielt er still und wartete.
Schedrag, die beiden anderen älteren Priester und Tugomir traten vor, bildeten einen Kreis um das Opfer, legten einander die Hände auf die Schultern und begannen sich zu wiegen und leise zu singen. Der Fürst und die Krieger lauschten ehrfurchtsvoll den gesungenen Gebeten, mit denen die Priester Jarovit anflehten, ihr Opfer gnädig anzunehmen. Als der getragene Gesang endete, war es mit einem Mal sehr still im Tempel. Selbst hier oben auf ihrem Lauerposten spürte Dragomira die gespannte Erwartung, die unter den Kriegern herrschte. Der Winter, die Entbehrungen und die ständige Bedrohung durch die Belagerung hatten die Männer grimmig gemacht, wusste sie, und das Gebräu in ihren Bechern stachelte sie weiter an. Sie wollten Blut sehen.
Schedrag löste sich von den anderen Priestern, trat zu Anno und legte ihm beide Hände auf den Kopf. Der Blinde fuhr fast unmerklich zusammen, sank dann aber unter dem sanften Druck der Hände bereitwillig auf die Knie. Die beiden anderen Priester nahmen seine Handgelenke, führten sie auf den Rücken und banden sie mit einem Lederriemen. Tugomir wandte sich ab, ging in den rückwärtigen Teil des Tempels, hob ein Messer mit einem kostbaren Bernsteingriff aus einer der Truhen und brachte es dem Hohepriester.
Sein Gesicht war ernst und konzentriert - nichts sonst. Niemand hätte erraten können, dass das Opfer, das da duldsam wie ein ahnungsloses Kälbchen zu seinen Füßen kniete, sein Freund war.
Dragomira begann sich gerade zu fragen, ob Tugomir vielleicht so berauscht war, dass er ganz und gar in die Götterwelt entrückt war, als Schedrag ihm das feine Messer zurückgab und mit einer Geste bedeutete, das Opfer zu vollziehen.
Dragomira biss sich hart auf die Zunge, um einen Laut des Schreckens zu unterdrücken.
Tugomir sah auf das Messer in seinen Händen. Lange, so kam es ihr vor. Dann hob er den Blick und schaute Schedrag an. Der uralte Priester nickte ihm ernst zu. »Ich weiß. Aber es muss sein. Deswegen haben die Götter ihn ausgewählt. Damit du es tun und dein Volk vor dem Untergang bewahren kannst. Der Einzige, für den es wirklich ein Opfer bedeutet.«
Dragomira spürte Tränen in den Augen brennen, hob für einen Moment den Kopf und fuhr sich mit dem linken Unterarm übers Gesicht. Es kam ihr vor, als laste ein Mühlstein auf ihrem Herzen, und endlich gestand sie sich ein, was sie schon lange geahnt hatte: Sie hasste Schedrag. Er war ein gerissener alter Wolf, der ihren Vater vollkommen beherrschte und ihren Bruder gestohlen hatte.
Und jetzt zwang er ihn, etwas so Grauenvolles zu tun. Etwas, das Tugomir sich vermutlich niemals vergeben konnte. Natürlich war ihr klar, dass es in Wirklichkeit Jarovit war, der all diese Dinge tat. Aber einen Gott zu hassen war verboten. Also blieb ihr nur der Hohepriester.
Tugomir zögerte immer noch.
»Wird's bald? Nun schlachte den blinden Kapaun endlich, du Jammerlappen«, lallte Bolilut, was ihm einen so unsanften Rippenstoß von ihrem Vater eintrug, dass er zur Seite kippte.
Tugomir schien ihn nicht gehört zu haben. Immer noch sah er Schedrag unverwandt an. Dann hielt er ihm das Messer kopfschüttelnd hin und öffnete die Lippen, um irgendetwas zu sagen.
Der Priester kam ihm zuvor: »Es ist deine letzte Prüfung, Tugomir. Ich weiß, sie ist die schwerste. Aber wenn du jetzt dein Schweigen brichst, war alles umsonst, was du auf dich genommen und was du gelernt hast.«
»Er hat recht, Tugomir«, sagte Anno. Die versammelten Krieger murmelten aufgebracht. Dragomira schloss, dass es sich für ein Opfer nicht gehörte, die Priester anzusprechen. Doch wie sie Anno kannte, war ihm das völlig gleich. Sie täuschte sich nicht: »Wirf nicht alles weg, was du sein wolltest, nur damit dieses Stück Dörrfleisch mir die Kehle durchschneidet «, fuhr er fort. »Mir ist es lieber, wenn du es tust, ehrlich. Komm schon. Und wenn du mir Respekt erweisen willst, dann lass mich nicht länger warten.«
Tugomir erwachte aus seiner Starre. Dragomira sah Tränen über seine Wangen laufen, als er hinter Anno trat, ihm die Linke auf die Stirn legte und den Hinterkopf gegen seinen Oberschenkel drückte. Dann setzte er ihm die scharfe Klinge an den Hals und schnitt ihm mit einer raschen, aber kontrollierten Bewegung die Kehle durch.
Ein Blutstrahl schoss aus der klaffenden Wunde und ertränkte zischend eine der Öllampen am Boden. Anno gab einen Laut von sich, der wie ein Seufzen klang, und sein Leib erschauderte, aber Tugomir hielt ihn weiter fest. Er hatte das kostbare Messer fallen lassen und dem Sterbenden die Rechte auf die Schulter gelegt.
Und so verharrte er, bis Annos Körper erschlaffte und der Blutstrom ein Rinnsal wurde.
Dragomira konnte nicht länger hinschauen. Es war nicht der Anblick des toten Freundes, den sie unerträglich fand, sondern das Gesicht ihres Bruders. Sie richtete sich auf und wandte den Kopf. Als sie das Feuer entdeckte, durchzuckte sie ein solcher Schreck, dass sie um ein Haar den Halt verloren hätte.
Die ganze Vorburg brannte lichterloh.
© 2013 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
... weniger
Autoren-Porträt von Rebecca Gablé
Rebecca Gablé, geboren 1964, studierte Literaturwissenschaft, Sprachgeschichte und Mediävistik in Düsseldorf, wo sie anschließend als Dozentin für mittelalterliche englische Literatur tätig war. Heute arbeitet sie als freie Autorin. Sie lebt mit ihrem Mann am Niederrhein, verbringt aber zur Recherche viel Zeit in England. Ihre historischen Romane und ihr Buch zur Geschichte des englischen Mittelalters wurden allesamt Bestseller und in viele Sprachen übersetzt.
Autoren-Interview mit Rebecca Gablé
Frau Gablé, in Ihrem neuen Roman über Otto den Großen sagen Sie über eine der Figuren (Tugomir): »Er sah sich außerstande, sich ein Dasein außerhalb seiner vertrauten Welt vorzustellen« - Ihnen gelingt das sehr gut.Rebecca Gablé: Wie die meisten Menschen im Mittelalter hat Tugomir bis zu diesem Punkt der Erzählung in einer Welt mit einem Radius von etwa zehn Kilometern gelebt. Jenseits davon beginnt das Unbekannte, Bedrohliche und Fremde. Er hatte auch keinen Zugang zu Literatur oder anderen Medien, um seinen Horizont zu erweitern. Beides ist bei mir anders.
Daher auch der Schritt, Ihren sicheren Job als Bankkauffrau zu kündigen, um Schriftstellerin zu werden?
Rebecca Gablé: Genau. Obwohl ich realistisch war und nicht geglaubt habe, dass es klappen würde. Aber ich habe gedacht, wenn ich es nicht versuche, werde ich das mein Leben lang bereuen.
Ein mutiger Schritt! Bis dato hatten Sie noch nichts veröffentlicht?
Rebecca Gablé: Nein, nur Absagen diverser Verlage erhalten. Bis ich ein Manuskript an Bastei Lübbe geschickt habe. Seither habe ich nie woanders veröffentlicht. Die ersten Verträge habe ich noch ohne Agent gemacht, so auch für »Das Lächeln der Fortuna«. Doch irgendwann, bei einem Bastei Lübbe Dinner während der Frankfurter Buchmesse, kam zu später Stunde - das war wie im Film - ein Mann auf mich zu, steckte mir konspirativ seine Visitenkarte zu und sagte: »Rufen Sie mich mal an«. Seitdem habe ich einen Literaturagenten ...
... und schreiben historische Romane. Wie kam es, dass Sie genau dieses Genre für sich entdeckt haben?
Rebecca Gablé: Durch mein Studium. Ich habe englische Literatur als Hauptfach gewählt. Die Studienordnung zwang mich, mittelalterliche Sprache und Literatur als Nebenfach zu
... mehr
wählen. Zuerst habe ich gedacht: »Oh Schreck, oh Graus«. Wider Erwarten hat es mir aber von der ersten Sekunde an große Freude bereitet, sodass ich mittelalterliche Sprache und Literatur zu meinem Hauptfach gemacht habe. Ich bekam einen Job am Lehrstuhl und war von da an völlig vom Mittelalter umgeben. Da lag es nahe, auch literarisch etwas in diese Richtung zu probieren, zumal sich der historische Roman zu dieser Zeit zu einem eigenen Genre entwickelte. »Der Medicus« war bereits erschienen und »Die Säulen der Erde« stürmten die Bestsellerliste. Als Leserin hat mich der historische Roman fasziniert. In diesem Genre wollte ich auch schreiben.
Bei dem akademischen Hintergrund drängt sich die Frage auf, wie viel in Ihren Romanen Fakt, wie viel Fiktion ist?
Rebecca Gablé: Dem historisch verbrieften Personal meiner Romane, das ja meist in der Überzahl ist, dichte ich keine Taten an, die sie nicht tatsächlich vollbracht haben. Aber in dem Moment, da ich sie zu Romanfiguren mache, werden sie fiktionalisiert. Ich bemühe mich, ihre Charaktere so zu beschreiben, wie sie nach meiner Deutung wahrscheinlich waren, aber dessen ungeachtet werden sie zu Geschöpfen meiner Fantasie mit einer eigenen Ausdrucksweise und Körpersprache, mit Dialogen und Emotionen. Umgekehrt achte ich darauf, dass meine erfundenen Figuren typisch für ihre Zeit sind. Ihre persönliche Geschichte wird immer von den politischen und sozialen Verhältnissen bestimmt, die ihre Epoche geprägt haben. So werden Fakten und Fiktion auf allen Ebenen miteinander verwoben.
Finden Sie die historischen Figuren, die Sie beschreiben, in Ihrer Seele vor? Mit all ihren guten und schlechten Seiten, mit ihren Vorzügen und Lastern?
Rebecca Gablé: Um Himmels willen! Dann wäre ich wohl reif für die Anstalt. Sicher gibt es Schriftsteller, die nur ein Spiegelbild ihrer eigenen Seele als literaturtauglich erachten. Das ist aller Ehren wert, aber zu dieser Sorte Schriftsteller gehöre ich nicht. Ich nutze Fantasie, um meine Figuren zu entwickeln. Damit bin ich zum Glück reichlich gesegnet, andernfalls könnte ich mich wohl kaum in einen mittelalterlichen Zeitgeist oder eine männliche Psyche versetzen, um sie glaubhaft zu beschreiben.
Was genau reizt Sie daran, Personen, die seit hunderten von Jahren tot sind, wieder zum Leben zu erwecken?
Rebecca Gablé: Der Reiz liegt darin, dass die Vergangenheit, speziell das Mittelalter, sich radikal von der heutigen Zeit unterscheidet, und trotzdem finden wir Vertrautes. Das Mittelalter ist, wie Barbara Tuchman gesagt hat, ein »ferner Spiegel« für uns. Und je gründlicher wir hineinschauen, desto besser können wir verstehen, wie wir zu der Gesellschaft wurden, die wir heute sind.
Was sehen Sie, wenn Sie in diesen »fernen Spiegel« hineinschauen?
Rebecca Gablé: Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele von unseren heutigen Werten aus dieser Zeit stammen. Vor allem was den Umgang von Männern und Frauen betrifft. Da gibt es heute noch eine Idealvorstellung, die hat auch durchaus noch etwas mit Ritterlichkeit und Galanterie zu tun. Das sind Wertvorstellungen, die eigentlich aus dem 12. Jahrhundert stammen und sich 900 Jahre lang bewahrt haben. Natürlich haben sie sich gewandelt, aber die Ursprünge sind noch sehr klar erkennbar. Ich finde es erstaunlich, dass die Gesellschaft sich so stark verändert hat, aber so ein Wertekodex überdauert.
Otto der Große. Der hat vor rund 1.100 Jahren in Europa für eine neue Ordnung gekämpft. Wo sind Sie ihm begegnet? Wann? Warum Otto?
Rebecca Gablé: Ich wollte einen Roman über das deutsche Mittelalter schreiben. Da schien es mir sinnvoll, mit dem Anfang zu beginnen, den viele Historiker bei Otto bzw. seinem Vater festmachen. Darum also Otto. Und wenn man sich fürs Mittelalter interessiert, trifft man ihn zwangsläufig immer wieder, in Büchern, in Ausstellungen etc. Bis vor zwei Jahren waren wir aber nur flüchtige Bekannte. Er war mir vor allem als Schwiegervater der großartigen Kaiserin Theophanu begegnet und kam mir immer ein bisschen furchteinflößend vor: ein graubärtiger Patriarch, der alle und alles beherrscht. Umso verblüffter war ich über den Otto, den ich entdeckte, als ich ihn bei meiner Recherche näher kennenlernte: Er war ein Visionär, aber auch ein Zweifler, er war machtbewusst, aber nicht skrupellos, ein Pragmatiker, aber manchmal naiv, und er war jedes Mal todtraurig, wenn seine Brüder und Söhne gegen ihn rebellierten, was mehr als einmal passiert ist. Obwohl ich mich manchmal fürchterlich über ihn aufgeregt habe, ist er mir doch ziemlich ans Herz gewachsen.
Würden Sie uns zum Schluss noch verraten, in welcher Zeit Sie gerne leben würden?
Rebecca Gablé: Ich möchte in keiner anderen Zeit leben als heute, als Frau schon mal gar nicht. Je mehr ich über die Vergangenheit erfahre, desto glücklicher bin ich, dass das Schicksal mich in diese Gegenwart geführt hat.
Bei dem akademischen Hintergrund drängt sich die Frage auf, wie viel in Ihren Romanen Fakt, wie viel Fiktion ist?
Rebecca Gablé: Dem historisch verbrieften Personal meiner Romane, das ja meist in der Überzahl ist, dichte ich keine Taten an, die sie nicht tatsächlich vollbracht haben. Aber in dem Moment, da ich sie zu Romanfiguren mache, werden sie fiktionalisiert. Ich bemühe mich, ihre Charaktere so zu beschreiben, wie sie nach meiner Deutung wahrscheinlich waren, aber dessen ungeachtet werden sie zu Geschöpfen meiner Fantasie mit einer eigenen Ausdrucksweise und Körpersprache, mit Dialogen und Emotionen. Umgekehrt achte ich darauf, dass meine erfundenen Figuren typisch für ihre Zeit sind. Ihre persönliche Geschichte wird immer von den politischen und sozialen Verhältnissen bestimmt, die ihre Epoche geprägt haben. So werden Fakten und Fiktion auf allen Ebenen miteinander verwoben.
Finden Sie die historischen Figuren, die Sie beschreiben, in Ihrer Seele vor? Mit all ihren guten und schlechten Seiten, mit ihren Vorzügen und Lastern?
Rebecca Gablé: Um Himmels willen! Dann wäre ich wohl reif für die Anstalt. Sicher gibt es Schriftsteller, die nur ein Spiegelbild ihrer eigenen Seele als literaturtauglich erachten. Das ist aller Ehren wert, aber zu dieser Sorte Schriftsteller gehöre ich nicht. Ich nutze Fantasie, um meine Figuren zu entwickeln. Damit bin ich zum Glück reichlich gesegnet, andernfalls könnte ich mich wohl kaum in einen mittelalterlichen Zeitgeist oder eine männliche Psyche versetzen, um sie glaubhaft zu beschreiben.
Was genau reizt Sie daran, Personen, die seit hunderten von Jahren tot sind, wieder zum Leben zu erwecken?
Rebecca Gablé: Der Reiz liegt darin, dass die Vergangenheit, speziell das Mittelalter, sich radikal von der heutigen Zeit unterscheidet, und trotzdem finden wir Vertrautes. Das Mittelalter ist, wie Barbara Tuchman gesagt hat, ein »ferner Spiegel« für uns. Und je gründlicher wir hineinschauen, desto besser können wir verstehen, wie wir zu der Gesellschaft wurden, die wir heute sind.
Was sehen Sie, wenn Sie in diesen »fernen Spiegel« hineinschauen?
Rebecca Gablé: Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele von unseren heutigen Werten aus dieser Zeit stammen. Vor allem was den Umgang von Männern und Frauen betrifft. Da gibt es heute noch eine Idealvorstellung, die hat auch durchaus noch etwas mit Ritterlichkeit und Galanterie zu tun. Das sind Wertvorstellungen, die eigentlich aus dem 12. Jahrhundert stammen und sich 900 Jahre lang bewahrt haben. Natürlich haben sie sich gewandelt, aber die Ursprünge sind noch sehr klar erkennbar. Ich finde es erstaunlich, dass die Gesellschaft sich so stark verändert hat, aber so ein Wertekodex überdauert.
Otto der Große. Der hat vor rund 1.100 Jahren in Europa für eine neue Ordnung gekämpft. Wo sind Sie ihm begegnet? Wann? Warum Otto?
Rebecca Gablé: Ich wollte einen Roman über das deutsche Mittelalter schreiben. Da schien es mir sinnvoll, mit dem Anfang zu beginnen, den viele Historiker bei Otto bzw. seinem Vater festmachen. Darum also Otto. Und wenn man sich fürs Mittelalter interessiert, trifft man ihn zwangsläufig immer wieder, in Büchern, in Ausstellungen etc. Bis vor zwei Jahren waren wir aber nur flüchtige Bekannte. Er war mir vor allem als Schwiegervater der großartigen Kaiserin Theophanu begegnet und kam mir immer ein bisschen furchteinflößend vor: ein graubärtiger Patriarch, der alle und alles beherrscht. Umso verblüffter war ich über den Otto, den ich entdeckte, als ich ihn bei meiner Recherche näher kennenlernte: Er war ein Visionär, aber auch ein Zweifler, er war machtbewusst, aber nicht skrupellos, ein Pragmatiker, aber manchmal naiv, und er war jedes Mal todtraurig, wenn seine Brüder und Söhne gegen ihn rebellierten, was mehr als einmal passiert ist. Obwohl ich mich manchmal fürchterlich über ihn aufgeregt habe, ist er mir doch ziemlich ans Herz gewachsen.
Würden Sie uns zum Schluss noch verraten, in welcher Zeit Sie gerne leben würden?
Rebecca Gablé: Ich möchte in keiner anderen Zeit leben als heute, als Frau schon mal gar nicht. Je mehr ich über die Vergangenheit erfahre, desto glücklicher bin ich, dass das Schicksal mich in diese Gegenwart geführt hat.
... weniger
Bibliographische Angaben
- Autor: Rebecca Gablé
- 2013, 1. Aufl., 864 Seiten, Maße: 14,5 x 22 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Ehrenwirth
- ISBN-10: 3431038832
- ISBN-13: 9783431038835
- Erscheinungsdatum: 27.09.2013
Pressezitat
"Dank Gablé wird ein Stück vergessene Geschichte lebendig." Brigitte - Bücher-Special "Gablés Buch um den slawischen Fürstensohn Tugomir liest sich flüssig, spannend, einfach nur gut." Gala "Rebecca Gablé ist einmal mehr ein beachtenswerter Wurf gelungen: Indem sie authentische Geschichte lebendig und nachvollziehbar erzählt, weit weg vom akademischen Betrieb und dennoch nah an den Fakten. (...) Die Lektüre wühlt auf, vermittelt erstaunliche Erkenntnisse und rückt das frühe deutsche Mittelalter überzeugend in den Fokus. Was will man mehr?" Emmanuel van Stein, Kölner Stadt-Anzeiger
Kommentare zu "Das Haupt der Welt / Otto der Große Bd.1"




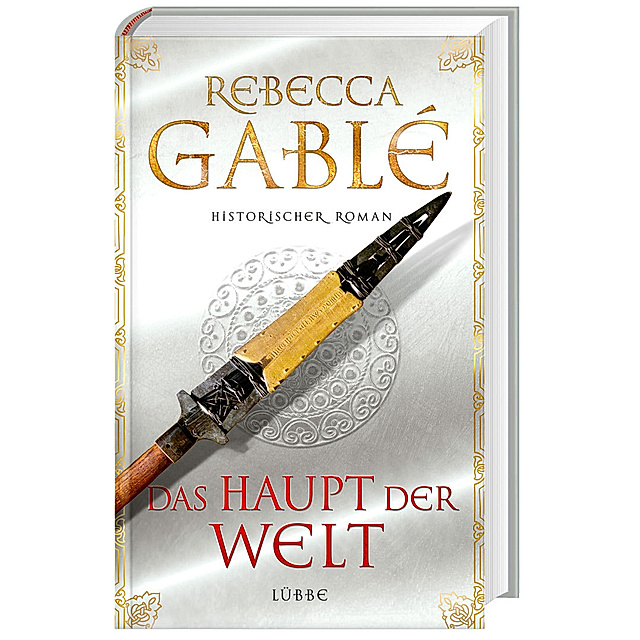


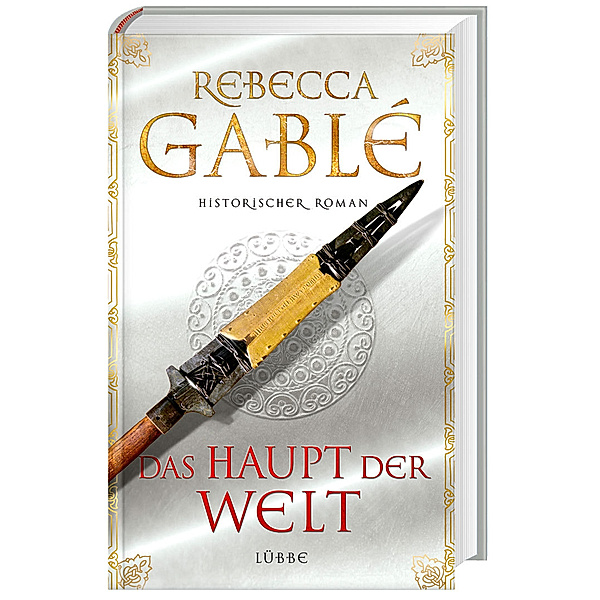

4.5 von 5 Sternen
5 Sterne 795Schreiben Sie einen Kommentar zu "Das Haupt der Welt / Otto der Große Bd.1".
Kommentar verfassen