Mord hat keine Tränen / Jessica Campbell Bd.2
Ein Fall für Jessica Campbell. Kriminalroman. Deutsche Erstausgabe
In einem baufälligen Haus mitten in London wird eine Leiche gefunden. Inspector Jessica Campbell nimmt die Ermittlungen auf. Der Besitzer des Hauses, der alte Monty Bickerstaffe scheint viele Geheimnisse zu haben - darunter auch eines, das Jessica persönlich betrifft.
lieferbar
versandkostenfrei
Taschenbuch
10.30 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Mord hat keine Tränen / Jessica Campbell Bd.2 “
In einem baufälligen Haus mitten in London wird eine Leiche gefunden. Inspector Jessica Campbell nimmt die Ermittlungen auf. Der Besitzer des Hauses, der alte Monty Bickerstaffe scheint viele Geheimnisse zu haben - darunter auch eines, das Jessica persönlich betrifft.
Klappentext zu „Mord hat keine Tränen / Jessica Campbell Bd.2 “
Als der alte Monty Bickerstaffe eine Leiche in seinem Landhaus mitten in den idyllischen Cotswolds entdeckt, ist dies nur die erste von vielen bösen Überraschungen. Mit seiner Ruhe ist es auf jeden Fall vorbei, denn Inspector Jesssica Campbell beginnt umgehend mit ihren Ermittlungen. Wer ist derTote, und warum wurde er ausgerechnet in diesem Haus abgelegt? Nachbarn und Verwandte Montys behaupten, ihn nie zuvor gesehen zu haben. Doch Jess ist überzeugt, dass jemand lügt. Zusammen mit Ian Carter muss sie tief in die Familiengeheimnisse der Bickerstaffes eindringen, um die schockierende Wahrheit ans Licht zu bringen ...
Lese-Probe zu „Mord hat keine Tränen / Jessica Campbell Bd.2 “
Mord hat keine Tränen - Ein Fall für Jessica Campbell von Ann GrangerKapitel 1
... mehr
Monty Bickerstaffe schlurfte in seinem charakteristischen Gang wankend und mit schwingenden Armen durch die Straßen. Die Bewegung gefährdete die flaschenförmige Beule in der durchhängenden Plastiktüte in seiner rechten Hand.
Seine vorherige Anwesenheit in der Spirituosenabteilung des Supermarktes hatte jegliche andere Kundschaft aus den Gängen vertrieben. Ein sehr junger Juniormanager hatte schließlich seinen Mut zusammengerafft und war an ihn herangetreten. »Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, hatte er seine Rede begonnen und anschließend unmissverständlich klargestellt, dass Montys Anwesenheit im Laden unerwünscht war.
»Rotznäsige halbe Portion!«, hatte Monty leise in sich hinein gebrummt. »Ich bin ein Kunde genau wie jeder andere auch!«
Und genau das hatte er dem jungen Mann auch zu verstehen gegeben. Auch dem älteren Burschen, der hinzugekommen war, um seinen jungen Kollegen zu unterstützen. Und dem Sicherheitsmann des Ladens. Dem hatte er darüber hinaus noch mehr erzählt.
»Ich werde Sie belangen, wegen Freiheitsberaubung!«, hatte er gedroht. »Sie können doch gar nicht wissen, ob ich nicht bezahlen will! Ich habe den Laden noch nicht verlassen! Bevor ich den Laden nicht verlassen habe, müssen Sie davon ausgehen, dass ich vorhabe zu bezahlen, was rein zufällig auch der Fall ist. Außerdem, junger Mann - Sie dürfen mich nicht durchsuchen, nicht einmal dann! Sie sind kein Constable. Sie müssen zuerst einen richtigen Constable rufen.«
»Ich kenne das Gesetz«, hatte der Sicherheitsmann des Supermarktes erwidert.
»Nicht so gut wie ich, mein Junge«, hatte Monty ihm entgegengehalten.
»Ja, sicher. Ich weiß, Monty. Warum verschonen Sie uns nicht?«
Sie hatten um ihn herumgestanden, während er bezahlt hatte. Das Mädchen an der Kasse war vor ihm zurückgewichen, als er ihr das Geld gereicht hatte, als ekelte sie sich, es anzufassen. Als wäre es durch den bloßen Kontakt mit Montys Hand kontaminiert.
»Badet er eigentlich niemals?«, hatte Monty im Weggehen ihre Kollegin an der benachbarten Kasse fragen gehört.
»Hey, schon gut! Nicht schubsen!«, hatte er den Sicherheitsmann angeraunzt. »Ich brauche eine Plastiktüte. Ich habe ein Recht auf eine Plastiktüte, und ich werde nicht dafür bezahlen! Ich habe genug für meinen Whisky bezahlt!«
»Unser Geschäftsgrundsatz ... «, hatte der Juniormanager unklugerweise eingeworfen, »... unser Geschäftsgrundsatz lautet, dass die Kundschaft für Tüten bezahlen muss. Es ist nicht viel, nur fünf Cent. Und es hilft der Umwelt.«
»Wie denn das?«
»Es verringert die Anzahl von Tüten draußen auf der Straße.« Der Juniormanager, in Montys Augen kaum mehr als ein rotznäsiger Schuljunge, hatte in Richtung des Bürgersteigs jenseits des Fensters gewinkt. »Die Leute werfen sie sonst einfach überall weg.«
»Woher wollen Sie wissen, dass ich meine auch wegwerfe? Ich sollte vielleicht auch darauf hinweisen, dass, sollte diese Flasche meiner Hand entgleiten - weil Sie mir keine Plastiktüte gegeben haben -, sie zerbrechen wird, und die Glasscherben eine Menge mehr Probleme für die Umwelt hinterlassen.« Er hatte die Zähne zu einem Grinsen entblößt, vor dem alle zurückgeschreckt waren. »Außerdem, wenn ich die Scherben der zerbrochenen Flasche aufsammle, weil ich die Umwelt schützen will, könnte ich mich dabei ganz übel schneiden ... «
»Schon gut, schon gut«, hatte der Seniormanager resigniert gesagt und sich an die Kassiererin gewandt. »Geben Sie ihm seine Tragetasche, Janette, Himmelherrgott noch mal! «
Sie hatten ihn nach draußen eskortiert und in einer Reihe dagestanden und zugesehen, wie er sich auf den Nachhauseweg gemacht hatte.
Monty hatte den Geschäftsbezirk hinter sich gelassen, dann eine Ansammlung kleinerer Läden, eine der weniger gepflegten Wohngegenden der Stadt, schließlich eine etwas bessere, neuere Gegend mit Häusern im Cottage-Stil (»Kaninchenlöcher!«, pflegte er zu schimpfen) und war schließlich durch ein Loch in der Hecke neben einer Tankstelle an der Ringstraße angelangt.
Er trottete in seinem charakteristischen Passgang über den Außenbereich, ignorierte das freundliche Winken eines Mannes an einer der Zapfsäulen und überquerte die Straße, ohne das wütende Hupen und Schimpfen erschrockener Autofahrer zu beachten. Er hatte die Stadt hinter sich gelassen und war auf dem Weg hinaus aufs Land, und wie immer fühlte er sich mit jedem Schritt besser. Er wanderte an der Bankette entlang bis zum Abzweig und bog in das letzte Stück Weges ein, das Sträßchen hinunter, das unter dem Namen Toby's Gutter Lane bekannt war.
Heutzutage wusste längst niemand mehr, wer dieser Toby gewesen war, doch das Sträßchen hieß seit Menschengedenken so; der Name fand sich sogar auf einer alten Karte aus dem achtzehnten Jahrhundert. Es führte den Berg hinunter zur nächsten Hauptstraße, und bis zum heutigen Tag sammelte sich auf diesem Sträßchen nach starken Regenfällen das Wasser und floss hinunter wie in einer Gosse. Wo das Sträßchen in die Hauptstraße mündete, bildete sich in nassen Monaten regelmäßig ein großer Tümpel über die gesamte Fahrbahn hinweg. Jeden Winter schrieben überrumpelte Autofahrer Beschwerdebriefe an die Verwaltung.
Monty passierte das Straßenschild mit dem Namen darauf. Es stand wie betrunken nach rechts geneigt, seit Pete Sneddon es mit seinem Traktor vor zwei oder drei Jahren gerammt hatte. Seit damals war es immer mehr erdwärts gesunken und würde irgendwann ohne jeden Zweifel ganz umkippen.
»Ich schreibe selbst einen Brief an die Verwaltung!«, rief Monty einem Pferd auf einer Weide am Straßenrand zu. Die Weide gehörte ihm, genau wie die nächste, doch er nutzte das Land nicht. Es war Teil seines Puffers gegen die Welt da draußen.
Das Pferd gehörte nicht ihm, sondern Gary Colley. Pete Sneddon trieb hin und wieder ein paar Schafe auf die andere Weide. Wie Monty das sah, war das voll und ganz ausreichend für das Land, ermöglichte es ihm doch zugleich, jeden möglichen Interessenten schroff abzuweisen.
Das Pferd wieherte freundliche Zustimmung, oder vielleicht lachte es ihn auch einfach nur aus, weil selbst der dumme Gaul wusste, dass die Verwaltung wichtigere Dinge im Kopf hatte als Toby's Gutter Lane (und Montys Beschwerde).
Auf diese Weise benötigte Monty beinahe eine ganze Stunde bis zu seinem Heim. Früher einmal, sinnierte er, hätte er die Strecke in der Hälfte der Zeit zurücklegen können. Er glaubte zu bemerken, dass die Arthritis in seinen Knien schlimmer wurde. Selbst der Whisky reichte nicht mehr, um den Schmerz zu betäuben - doch als er das letzte Mal beim Arzt gewesen war, hatte sich die Helferin am Empfang noch schlimmer angestellt als das Jüngelchen vorhin im Supermarkt. Schlimmer noch, so ein schmächtiges junges Ding in Jeans mit nackter Taille und einer Tätowierung um den Bauchnabel hatte ihn beschuldigt, Krankheiten in die Praxis einzuschleppen.
»Das hier ist das Wartezimmer einer Arztpraxis, Fräulein«, hatte Monty sie informiert. »Das ist nun mal der Ort, an den man kommt, um sich Krankheiten einzufangen.«
Bei diesen Worten hatten sämtliche anderen Patienten sich gerührt und versucht, auf möglichst große Distanz zu ihren kranken Nachbarn zu gehen - und alle zusammen waren vor Monty weggerückt.
»Leben und leben lassen!«, sagte Monty laut zu sich selbst. Seine Stimmung besserte sich schlagartig, jetzt, wo er zu Hause war. Er schob sich durch den schmalen Spalt des rostigen Eisentors. Die Angeln waren längst festgerostet, und die Flügel bewegten sich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Der Spalt war gerade breit genug, ein einzelnes menschliches Wesen hindurchzulassen. Winden rankten über den Gitterstäben und verbargen den Blick nicht nur auf ein hübsches Beispiel schmiedeeiserner Handwerkskunst des neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch auf die unkrautübersäte Auffahrt zum Haupteingang von Balaclava House, einem ehemals ausgesprochen ansehnlichen Bauwerk in viktorianischer Spätgotik. Längst hatten die Ziegel angefangen zu verwittern. Über der Eingangsveranda zog sich ein wie ein Blitz geformter gezackter Riss bis hinauf in den ersten Stock und spaltete ein Wappenschild, das Montys Urgroßvater entworfen hatte in dem Versuch, eine durch und durch imaginäre Verbindung zum Adel anzudeuten.
Monty war seit Jahren nicht mehr die breiten Stufen zu den oberen Stockwerken hinaufgestiegen. Seine Knie spielten nicht mit, und er verspürte darüber hinaus keinerlei Begierde zu sehen, wie weit der Zustand des Zerfalls in den oberen Zimmern fortgeschritten war. Er lebte ausschließlich im Erdgeschoss. Raum gab es mehr als genug hier unten. Neben der geräumigen Eingangshalle gab es eine große Garderobe, ein wohlproportioniertes Wohnzimmer, ein Esszimmer, einen Anrichteraum und eine riesige Küche, zusammen mit einem rückwärtigen Flur und einem kleinen Raum, den Monty nur das »Waffenzimmer« nannte, obwohl es längst keine Jagdwaffen mehr enthielt. Die Polizei hatte die Waffen vor einigen Jahren einkassiert und mitgenommen, weil Monty keine Lizenz besaß. Es waren die Waffen seines Vaters, und Monty war äußerst erbost darüber gewesen, dass man ihn seines Familieneigentums beraubt hatte. Heutzutage sammelte er im Waffenzimmer seine leeren Whiskyflaschen, und angesichts der Tatsache, dass er kein Transportmittel zur Verfügung hatte, um sie zum Altglascontainer zu bringen, hatte er das Zimmer im Lauf der Jahre ziemlich gefüllt.
Seine Familie hatte dieses Haus gebaut, in den 1850er Jahren, und seitdem lebte sie hier. Der allmähliche Niedergang hatte bereits in den 1950er Jahren eingesetzt, lange bevor Monty Balaclava House geerbt hatte, zu einer Zeit, als Haushaltshilfen kostspielig geworden waren und schwer zu finden. Etwa um die gleiche Zeit war das Familienunternehmen immer weniger profitabel geworden. Monty erinnerte sich, wie sein Vater und seine Mutter zu illegalen kleinen »Sparmaßnahmen« gegriffen hatten, um die Situation zu meistern. Im Falle seines Vaters hatte das beispielsweise beinhaltet, billige Weinsorten umzufüllen in Flaschen mit besseren Etiketten. Gelegentlich hatte er auch einen Schluck Port hinzugefügt, um den Geschmack zu verbessern. Seine Mutter hatte ihre eigene Methode zu sparen. Mahlzeiten aus Resten dominierten Montys Erinnerungen an Ferien zu Hause. Mahlzeiten aus Resten waren auch während des Schuljahres eine der wichtigsten Nahrungsquellen für ihn gewesen. Als Erwachsener hatte er gelegentlich sinniert, dass er mehr oder weniger vollständig mit aufgewärmtem oder wiederverwendetem Zeug aufgezogen worden war. Selbst die baumwollenen Bettlaken waren, wenn sie dünn wurden, von den Seiten auf die Mitte gewendet worden, was in einer langen, unangenehm scheuernden Naht in der Mitte des Lakens resultiert hatte. Das Haus war stets kalt gewesen. Nach Montys Meinung jedoch hatte ihm das alles nicht geschadet - es hatte ihn im Gegenteil hart gemacht.
Er humpelte durch den leeren, hallenden Flur, blind für den Staub, der dick auf sämtlichen Möbeln lag, stieß die Tür zum Wohnzimmer auf und ging zu dem Sideboard, in dem er seine Gläser aufbewahrte. Monty öffnete eine Schranktür, stellte fest, dass kein sauberes Glas mehr darin war, und probierte die nächste. Immer noch kein Glück. Offensichtlich musste er schon wieder abwaschen, und er hatte erst vor drei oder vier Tagen die letzte Ladung gespült. Wenn man bedachte, dass er der einzige Bewohner war, hätte man meinen sollen, einmal in der Woche reichte aus.
Monty stellte die neu erworbene Flasche behutsam ab, stieß einen Seufzer aus und machte sich auf den Weg zurück zur Küche auf der anderen Seite des Flurs. In diesem Augenblick bemerkte er, dass er nicht mehr die einzige Person in seinem Haus war.
Monty hatte Besuch. Fremden Besuch.
Zuerst glaubte er, seine Phantasie spielte ihm einen Streich. Kaum jemand war hier gewesen seit Jahresanfang, als eine Frau aufgetaucht war, die sich als Sozialarbeiterin ausgegeben hatte. Wie es schien, hatte ein übereifriger Wichtigtuer auf dem Amt gemeldet, dass »ein älterer Gentleman, offensichtlich nicht mehr ganz richtig im Kopf, in einem völlig heruntergekommenen und verwahrlosten Haus« lebte.
Um bei der Wahrheit zu bleiben, die Frauensperson hatte nicht die Worte »nicht mehr ganz richtig im Kopf« benutzt. Stattdessen hatte sie gesagt: »Vielleicht sind wir hin und wieder ein wenig verwirrt?«
»Ich wusste gar nicht, dass Ihre Majestät mir einen Besuch abstattet«, hatte Monty entgegnet. »Ich nehme doch an, Sie benutzen den Pluralis Majestatis und meinen sich selbst, wenn Sie von Verwirrung reden? Gut möglich wäre das nämlich. Es sieht jedenfalls ganz danach aus, wenn Sie glauben, Sie wären die Queen. Ich für meinen Teil bin bei vollkommen klarem Verstand.«
»Aber Sie wohnen ganz allein, mein Lieber«, hatte die Sozialarbeiterin gesagt. »Ganz allein in diesem großen, kalten Haus, und Sie haben offensichtlich keinerlei Zentralheizung.«
»Ich wohne gerne allein!«, hatte Monty der elenden Frau entgegengeschleudert. »Die Tatsache, dass ich allein wohne, ist mehr oder weniger das Einzige, worin Sie richtigliegen, Ma'am! Mein Verstand ist, wie ich bereits sagte, vollkommen klar. Der Zustand meines Haushaltes geht Sie im Übrigen überhaupt nichts an. Mein Haus sieht für mich völlig in Ordnung aus. Ich habe eine Heizung. Ich habe Feuer im Wohnzimmer. Ich habe mehr als genug Holz im Garten und alte Schuppen, um das Feuer zu unterhalten. Es kostet mich nichts und bedeutet, dass ich weniger Geld für Strom ausgeben muss. Ich bin auch nicht mehr ans Gas angeschlossen. Die Leitung wurde vor ein paar Jahren ersetzt, und sie wollten meinen Garten umgraben, um einen neuen Anschluss in mein Haus zu legen. Ich habe mich geweigert, und so wurde die neue Leitung gleich vor meiner Haustür verlegt ... «, er hatte über die Schulter der Frau nach draußen gezeigt, »... ohne dass ich einen Anschluss erhielt. Ich bezahle eine geradezu atemberaubende Summe an Gemeindesteuern und erhalte im Gegenzug dafür so gut wie keinerlei Dienstleistung von Seiten der Gemeinde. Also gehen Sie. Gehen Sie einfach.«
Sie war tatsächlich gegangen, nicht ohne ihm eine Auswahl an Flugblättern in die Hand zu drücken über Hilfe, die älteren Bürgern zustand. Monty hatte sie ins Feuer geworfen, wo sie sich den knisternden Überresten seines Gartenschuppens angeschlossen hatten.
Fünf Personen hatten seither bei ihm vorbeigeschaut. Doch das hier war etwas anderes. Das hier war definitiv ein unwillkommener Eindringling.
Monty war außer sich. Hatte man denn heutzutage überhaupt keine Privatsphäre mehr? Zumindest hatte es sich der Eindringling nicht auf Montys Chaiselongue bequem gemacht - ein schwacher Trost. Das Möbel diente Monty nämlich als Bett. Der Fremde hatte es sich auf dem mit Rosshaar ausgestopften viktorianischen Sofa bequem gemacht, richtig bequem, um nicht zu sagen, er hatte sich auf den modernden Kissen und Polstern hingeflegelt. Er schien fest zu schlafen. Monty zermarterte sich das Gehirn, ob er ihn nicht vielleicht doch kannte. Nein, er hatte nicht die geringste Ahnung, wer der Kerl war. Der Fremde war wohlgenährt und trug eine braune Kordhose, ein blau kariertes Hemd mit offenem Kragen und eine Wildlederjacke. Er war nicht mehr jung, aber auch noch nicht sonderlich alt. Nach Montys Dafürhalten sah er aus wie ein feiner Pinkel.
»Wer in drei Teufels Namen sind Sie?«, schnappte Monty. »Das hier ist ein privates Wohnhaus, Sir!«
Der Bursche antwortete nicht. Monty schob sich ein wenig näher, ohne einen gewissen Sicherheitsabstand zu unterschreiten, und musterte den Fremden eingehender.
Zu seinem Abscheu stellte er fest, dass der Bursche gesabbert hatte und der Speichel auf seinem Kinn getrocknet war. Er hatte eine silberne Spur auf der Haut hinterlassen, wie von einer Schnecke. Schlimmer noch, dem Kerl war allem Anschein nach ein übles Missgeschick passiert. Der verräterisch stinkende Fleck zwischen seinen Beinen war schon fast wieder getrocknet.
Monty rümpfte die Nase. »Wohl zu viel getrunken, was, alter Junge? Glauben Sie mir, niemand versteht das besser als ich. Trotzdem, Sie können nicht hierbleiben, wissen Sie?«
Der Fremde antwortete nicht. Monty räusperte sich laut und forderte den Fremden erneut in schroffem Ton auf, endlich aufzuwachen. Der Besucher schlummerte weiter.
Ärger gewann die Oberhand über Vorsicht. Monty packte einen Wildlederärmel und schüttelte ihn unsanft - ohne Ergebnis. Die Gestalt rührte sich nicht. Überhaupt nicht. Der Gestank nach getrocknetem Urin war durch das Schütteln stärker geworden.
Monty stieß einen langgezogenen, leisen Pfiff aus. Er warf einen Blick zur Tür und stellte erleichtert fest, dass sie offen stand und er, sollten seine Knie dies erlauben, die Flucht ergreifen konnte. Im gleichen Moment fiel ihm auch wieder ein, dass die Tür immer offen stand. Er schloss die Zimmertüren nie, weil dies lediglich bedeutete, dass er sie wieder öffnen musste, wenn er in eines der Zimmer wollte. Die Wohnzimmertür jedoch war geschlossen gewesen, definitiv geschlossen, als er nach Hause gekommen war. Er erinnerte sich deutlich, dass er sie geöffnet hatte beim Betreten des Wohnzimmers, keine fünf Minuten zuvor. Der Bursche auf seinem Sofa musste sie geschlossen haben.
Oder vielleicht auch jemand anders, nachdem er den Burschen auf Montys Sofa abgelegt hatte - denn der Kerl erweckte in Monty eine dunkle Befürchtung. Nämlich, dass er tot sein könnte. Das vollgesabberte Hemd hob und senkte sich nicht wie bei jemandem, der im Schlaf atmete. Er schien sich übergeben zu haben, und auch das Erbrochene war getrocknet.
»Hey!«, rief Monty noch einmal, ohne rechte Hoffnung auf eine Antwort.
Seine Stimme hallte ungehört durch das Zimmer. »Verdammter Mist!«, fluchte er und wich einen Schritt zurück.
Das ließ die gesamte Angelegenheit in einem gänzlich neuen Licht erscheinen. Wäre der Kerl am Leben gewesen, hätte Monty ihn rausgeworfen und ihm gesagt, dass er verschwinden solle.
Doch das ging nicht bei einem Toten, und ignorieren ließ sich so ein Toter ebenfalls nicht.
Vorsichtig schob sich Monty weiter zurück und aus dem Zimmer. Er eilte durch den Flur und in die Küche, packte ein schmutziges Glas, spülte es unter fließendem Wasser ab und kehrte damit - sehr viel langsamer jetzt - zurück ins Wohnzimmer.
Er hatte insgeheim - und ziemlich unlogisch - gehofft, dass sein Besucher auf die gleiche unerklärliche Weise verschwunden sein könnte, auf die er gekommen war. Sich in Luft aufgelöst haben könnte. Doch nein, er war immer noch da. Monty machte einen Bogen um das Sofa und ging zu seiner Whiskyflasche. Schenkte sich einen großzügigen Schluck ein und setzte sich damit auf einen Sessel gegenüber dem Leichnam, um über die Frage nachzudenken, was als Nächstes zu tun war.
Übersetzung: Axel Merz
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Monty Bickerstaffe schlurfte in seinem charakteristischen Gang wankend und mit schwingenden Armen durch die Straßen. Die Bewegung gefährdete die flaschenförmige Beule in der durchhängenden Plastiktüte in seiner rechten Hand.
Seine vorherige Anwesenheit in der Spirituosenabteilung des Supermarktes hatte jegliche andere Kundschaft aus den Gängen vertrieben. Ein sehr junger Juniormanager hatte schließlich seinen Mut zusammengerafft und war an ihn herangetreten. »Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, hatte er seine Rede begonnen und anschließend unmissverständlich klargestellt, dass Montys Anwesenheit im Laden unerwünscht war.
»Rotznäsige halbe Portion!«, hatte Monty leise in sich hinein gebrummt. »Ich bin ein Kunde genau wie jeder andere auch!«
Und genau das hatte er dem jungen Mann auch zu verstehen gegeben. Auch dem älteren Burschen, der hinzugekommen war, um seinen jungen Kollegen zu unterstützen. Und dem Sicherheitsmann des Ladens. Dem hatte er darüber hinaus noch mehr erzählt.
»Ich werde Sie belangen, wegen Freiheitsberaubung!«, hatte er gedroht. »Sie können doch gar nicht wissen, ob ich nicht bezahlen will! Ich habe den Laden noch nicht verlassen! Bevor ich den Laden nicht verlassen habe, müssen Sie davon ausgehen, dass ich vorhabe zu bezahlen, was rein zufällig auch der Fall ist. Außerdem, junger Mann - Sie dürfen mich nicht durchsuchen, nicht einmal dann! Sie sind kein Constable. Sie müssen zuerst einen richtigen Constable rufen.«
»Ich kenne das Gesetz«, hatte der Sicherheitsmann des Supermarktes erwidert.
»Nicht so gut wie ich, mein Junge«, hatte Monty ihm entgegengehalten.
»Ja, sicher. Ich weiß, Monty. Warum verschonen Sie uns nicht?«
Sie hatten um ihn herumgestanden, während er bezahlt hatte. Das Mädchen an der Kasse war vor ihm zurückgewichen, als er ihr das Geld gereicht hatte, als ekelte sie sich, es anzufassen. Als wäre es durch den bloßen Kontakt mit Montys Hand kontaminiert.
»Badet er eigentlich niemals?«, hatte Monty im Weggehen ihre Kollegin an der benachbarten Kasse fragen gehört.
»Hey, schon gut! Nicht schubsen!«, hatte er den Sicherheitsmann angeraunzt. »Ich brauche eine Plastiktüte. Ich habe ein Recht auf eine Plastiktüte, und ich werde nicht dafür bezahlen! Ich habe genug für meinen Whisky bezahlt!«
»Unser Geschäftsgrundsatz ... «, hatte der Juniormanager unklugerweise eingeworfen, »... unser Geschäftsgrundsatz lautet, dass die Kundschaft für Tüten bezahlen muss. Es ist nicht viel, nur fünf Cent. Und es hilft der Umwelt.«
»Wie denn das?«
»Es verringert die Anzahl von Tüten draußen auf der Straße.« Der Juniormanager, in Montys Augen kaum mehr als ein rotznäsiger Schuljunge, hatte in Richtung des Bürgersteigs jenseits des Fensters gewinkt. »Die Leute werfen sie sonst einfach überall weg.«
»Woher wollen Sie wissen, dass ich meine auch wegwerfe? Ich sollte vielleicht auch darauf hinweisen, dass, sollte diese Flasche meiner Hand entgleiten - weil Sie mir keine Plastiktüte gegeben haben -, sie zerbrechen wird, und die Glasscherben eine Menge mehr Probleme für die Umwelt hinterlassen.« Er hatte die Zähne zu einem Grinsen entblößt, vor dem alle zurückgeschreckt waren. »Außerdem, wenn ich die Scherben der zerbrochenen Flasche aufsammle, weil ich die Umwelt schützen will, könnte ich mich dabei ganz übel schneiden ... «
»Schon gut, schon gut«, hatte der Seniormanager resigniert gesagt und sich an die Kassiererin gewandt. »Geben Sie ihm seine Tragetasche, Janette, Himmelherrgott noch mal! «
Sie hatten ihn nach draußen eskortiert und in einer Reihe dagestanden und zugesehen, wie er sich auf den Nachhauseweg gemacht hatte.
Monty hatte den Geschäftsbezirk hinter sich gelassen, dann eine Ansammlung kleinerer Läden, eine der weniger gepflegten Wohngegenden der Stadt, schließlich eine etwas bessere, neuere Gegend mit Häusern im Cottage-Stil (»Kaninchenlöcher!«, pflegte er zu schimpfen) und war schließlich durch ein Loch in der Hecke neben einer Tankstelle an der Ringstraße angelangt.
Er trottete in seinem charakteristischen Passgang über den Außenbereich, ignorierte das freundliche Winken eines Mannes an einer der Zapfsäulen und überquerte die Straße, ohne das wütende Hupen und Schimpfen erschrockener Autofahrer zu beachten. Er hatte die Stadt hinter sich gelassen und war auf dem Weg hinaus aufs Land, und wie immer fühlte er sich mit jedem Schritt besser. Er wanderte an der Bankette entlang bis zum Abzweig und bog in das letzte Stück Weges ein, das Sträßchen hinunter, das unter dem Namen Toby's Gutter Lane bekannt war.
Heutzutage wusste längst niemand mehr, wer dieser Toby gewesen war, doch das Sträßchen hieß seit Menschengedenken so; der Name fand sich sogar auf einer alten Karte aus dem achtzehnten Jahrhundert. Es führte den Berg hinunter zur nächsten Hauptstraße, und bis zum heutigen Tag sammelte sich auf diesem Sträßchen nach starken Regenfällen das Wasser und floss hinunter wie in einer Gosse. Wo das Sträßchen in die Hauptstraße mündete, bildete sich in nassen Monaten regelmäßig ein großer Tümpel über die gesamte Fahrbahn hinweg. Jeden Winter schrieben überrumpelte Autofahrer Beschwerdebriefe an die Verwaltung.
Monty passierte das Straßenschild mit dem Namen darauf. Es stand wie betrunken nach rechts geneigt, seit Pete Sneddon es mit seinem Traktor vor zwei oder drei Jahren gerammt hatte. Seit damals war es immer mehr erdwärts gesunken und würde irgendwann ohne jeden Zweifel ganz umkippen.
»Ich schreibe selbst einen Brief an die Verwaltung!«, rief Monty einem Pferd auf einer Weide am Straßenrand zu. Die Weide gehörte ihm, genau wie die nächste, doch er nutzte das Land nicht. Es war Teil seines Puffers gegen die Welt da draußen.
Das Pferd gehörte nicht ihm, sondern Gary Colley. Pete Sneddon trieb hin und wieder ein paar Schafe auf die andere Weide. Wie Monty das sah, war das voll und ganz ausreichend für das Land, ermöglichte es ihm doch zugleich, jeden möglichen Interessenten schroff abzuweisen.
Das Pferd wieherte freundliche Zustimmung, oder vielleicht lachte es ihn auch einfach nur aus, weil selbst der dumme Gaul wusste, dass die Verwaltung wichtigere Dinge im Kopf hatte als Toby's Gutter Lane (und Montys Beschwerde).
Auf diese Weise benötigte Monty beinahe eine ganze Stunde bis zu seinem Heim. Früher einmal, sinnierte er, hätte er die Strecke in der Hälfte der Zeit zurücklegen können. Er glaubte zu bemerken, dass die Arthritis in seinen Knien schlimmer wurde. Selbst der Whisky reichte nicht mehr, um den Schmerz zu betäuben - doch als er das letzte Mal beim Arzt gewesen war, hatte sich die Helferin am Empfang noch schlimmer angestellt als das Jüngelchen vorhin im Supermarkt. Schlimmer noch, so ein schmächtiges junges Ding in Jeans mit nackter Taille und einer Tätowierung um den Bauchnabel hatte ihn beschuldigt, Krankheiten in die Praxis einzuschleppen.
»Das hier ist das Wartezimmer einer Arztpraxis, Fräulein«, hatte Monty sie informiert. »Das ist nun mal der Ort, an den man kommt, um sich Krankheiten einzufangen.«
Bei diesen Worten hatten sämtliche anderen Patienten sich gerührt und versucht, auf möglichst große Distanz zu ihren kranken Nachbarn zu gehen - und alle zusammen waren vor Monty weggerückt.
»Leben und leben lassen!«, sagte Monty laut zu sich selbst. Seine Stimmung besserte sich schlagartig, jetzt, wo er zu Hause war. Er schob sich durch den schmalen Spalt des rostigen Eisentors. Die Angeln waren längst festgerostet, und die Flügel bewegten sich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Der Spalt war gerade breit genug, ein einzelnes menschliches Wesen hindurchzulassen. Winden rankten über den Gitterstäben und verbargen den Blick nicht nur auf ein hübsches Beispiel schmiedeeiserner Handwerkskunst des neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch auf die unkrautübersäte Auffahrt zum Haupteingang von Balaclava House, einem ehemals ausgesprochen ansehnlichen Bauwerk in viktorianischer Spätgotik. Längst hatten die Ziegel angefangen zu verwittern. Über der Eingangsveranda zog sich ein wie ein Blitz geformter gezackter Riss bis hinauf in den ersten Stock und spaltete ein Wappenschild, das Montys Urgroßvater entworfen hatte in dem Versuch, eine durch und durch imaginäre Verbindung zum Adel anzudeuten.
Monty war seit Jahren nicht mehr die breiten Stufen zu den oberen Stockwerken hinaufgestiegen. Seine Knie spielten nicht mit, und er verspürte darüber hinaus keinerlei Begierde zu sehen, wie weit der Zustand des Zerfalls in den oberen Zimmern fortgeschritten war. Er lebte ausschließlich im Erdgeschoss. Raum gab es mehr als genug hier unten. Neben der geräumigen Eingangshalle gab es eine große Garderobe, ein wohlproportioniertes Wohnzimmer, ein Esszimmer, einen Anrichteraum und eine riesige Küche, zusammen mit einem rückwärtigen Flur und einem kleinen Raum, den Monty nur das »Waffenzimmer« nannte, obwohl es längst keine Jagdwaffen mehr enthielt. Die Polizei hatte die Waffen vor einigen Jahren einkassiert und mitgenommen, weil Monty keine Lizenz besaß. Es waren die Waffen seines Vaters, und Monty war äußerst erbost darüber gewesen, dass man ihn seines Familieneigentums beraubt hatte. Heutzutage sammelte er im Waffenzimmer seine leeren Whiskyflaschen, und angesichts der Tatsache, dass er kein Transportmittel zur Verfügung hatte, um sie zum Altglascontainer zu bringen, hatte er das Zimmer im Lauf der Jahre ziemlich gefüllt.
Seine Familie hatte dieses Haus gebaut, in den 1850er Jahren, und seitdem lebte sie hier. Der allmähliche Niedergang hatte bereits in den 1950er Jahren eingesetzt, lange bevor Monty Balaclava House geerbt hatte, zu einer Zeit, als Haushaltshilfen kostspielig geworden waren und schwer zu finden. Etwa um die gleiche Zeit war das Familienunternehmen immer weniger profitabel geworden. Monty erinnerte sich, wie sein Vater und seine Mutter zu illegalen kleinen »Sparmaßnahmen« gegriffen hatten, um die Situation zu meistern. Im Falle seines Vaters hatte das beispielsweise beinhaltet, billige Weinsorten umzufüllen in Flaschen mit besseren Etiketten. Gelegentlich hatte er auch einen Schluck Port hinzugefügt, um den Geschmack zu verbessern. Seine Mutter hatte ihre eigene Methode zu sparen. Mahlzeiten aus Resten dominierten Montys Erinnerungen an Ferien zu Hause. Mahlzeiten aus Resten waren auch während des Schuljahres eine der wichtigsten Nahrungsquellen für ihn gewesen. Als Erwachsener hatte er gelegentlich sinniert, dass er mehr oder weniger vollständig mit aufgewärmtem oder wiederverwendetem Zeug aufgezogen worden war. Selbst die baumwollenen Bettlaken waren, wenn sie dünn wurden, von den Seiten auf die Mitte gewendet worden, was in einer langen, unangenehm scheuernden Naht in der Mitte des Lakens resultiert hatte. Das Haus war stets kalt gewesen. Nach Montys Meinung jedoch hatte ihm das alles nicht geschadet - es hatte ihn im Gegenteil hart gemacht.
Er humpelte durch den leeren, hallenden Flur, blind für den Staub, der dick auf sämtlichen Möbeln lag, stieß die Tür zum Wohnzimmer auf und ging zu dem Sideboard, in dem er seine Gläser aufbewahrte. Monty öffnete eine Schranktür, stellte fest, dass kein sauberes Glas mehr darin war, und probierte die nächste. Immer noch kein Glück. Offensichtlich musste er schon wieder abwaschen, und er hatte erst vor drei oder vier Tagen die letzte Ladung gespült. Wenn man bedachte, dass er der einzige Bewohner war, hätte man meinen sollen, einmal in der Woche reichte aus.
Monty stellte die neu erworbene Flasche behutsam ab, stieß einen Seufzer aus und machte sich auf den Weg zurück zur Küche auf der anderen Seite des Flurs. In diesem Augenblick bemerkte er, dass er nicht mehr die einzige Person in seinem Haus war.
Monty hatte Besuch. Fremden Besuch.
Zuerst glaubte er, seine Phantasie spielte ihm einen Streich. Kaum jemand war hier gewesen seit Jahresanfang, als eine Frau aufgetaucht war, die sich als Sozialarbeiterin ausgegeben hatte. Wie es schien, hatte ein übereifriger Wichtigtuer auf dem Amt gemeldet, dass »ein älterer Gentleman, offensichtlich nicht mehr ganz richtig im Kopf, in einem völlig heruntergekommenen und verwahrlosten Haus« lebte.
Um bei der Wahrheit zu bleiben, die Frauensperson hatte nicht die Worte »nicht mehr ganz richtig im Kopf« benutzt. Stattdessen hatte sie gesagt: »Vielleicht sind wir hin und wieder ein wenig verwirrt?«
»Ich wusste gar nicht, dass Ihre Majestät mir einen Besuch abstattet«, hatte Monty entgegnet. »Ich nehme doch an, Sie benutzen den Pluralis Majestatis und meinen sich selbst, wenn Sie von Verwirrung reden? Gut möglich wäre das nämlich. Es sieht jedenfalls ganz danach aus, wenn Sie glauben, Sie wären die Queen. Ich für meinen Teil bin bei vollkommen klarem Verstand.«
»Aber Sie wohnen ganz allein, mein Lieber«, hatte die Sozialarbeiterin gesagt. »Ganz allein in diesem großen, kalten Haus, und Sie haben offensichtlich keinerlei Zentralheizung.«
»Ich wohne gerne allein!«, hatte Monty der elenden Frau entgegengeschleudert. »Die Tatsache, dass ich allein wohne, ist mehr oder weniger das Einzige, worin Sie richtigliegen, Ma'am! Mein Verstand ist, wie ich bereits sagte, vollkommen klar. Der Zustand meines Haushaltes geht Sie im Übrigen überhaupt nichts an. Mein Haus sieht für mich völlig in Ordnung aus. Ich habe eine Heizung. Ich habe Feuer im Wohnzimmer. Ich habe mehr als genug Holz im Garten und alte Schuppen, um das Feuer zu unterhalten. Es kostet mich nichts und bedeutet, dass ich weniger Geld für Strom ausgeben muss. Ich bin auch nicht mehr ans Gas angeschlossen. Die Leitung wurde vor ein paar Jahren ersetzt, und sie wollten meinen Garten umgraben, um einen neuen Anschluss in mein Haus zu legen. Ich habe mich geweigert, und so wurde die neue Leitung gleich vor meiner Haustür verlegt ... «, er hatte über die Schulter der Frau nach draußen gezeigt, »... ohne dass ich einen Anschluss erhielt. Ich bezahle eine geradezu atemberaubende Summe an Gemeindesteuern und erhalte im Gegenzug dafür so gut wie keinerlei Dienstleistung von Seiten der Gemeinde. Also gehen Sie. Gehen Sie einfach.«
Sie war tatsächlich gegangen, nicht ohne ihm eine Auswahl an Flugblättern in die Hand zu drücken über Hilfe, die älteren Bürgern zustand. Monty hatte sie ins Feuer geworfen, wo sie sich den knisternden Überresten seines Gartenschuppens angeschlossen hatten.
Fünf Personen hatten seither bei ihm vorbeigeschaut. Doch das hier war etwas anderes. Das hier war definitiv ein unwillkommener Eindringling.
Monty war außer sich. Hatte man denn heutzutage überhaupt keine Privatsphäre mehr? Zumindest hatte es sich der Eindringling nicht auf Montys Chaiselongue bequem gemacht - ein schwacher Trost. Das Möbel diente Monty nämlich als Bett. Der Fremde hatte es sich auf dem mit Rosshaar ausgestopften viktorianischen Sofa bequem gemacht, richtig bequem, um nicht zu sagen, er hatte sich auf den modernden Kissen und Polstern hingeflegelt. Er schien fest zu schlafen. Monty zermarterte sich das Gehirn, ob er ihn nicht vielleicht doch kannte. Nein, er hatte nicht die geringste Ahnung, wer der Kerl war. Der Fremde war wohlgenährt und trug eine braune Kordhose, ein blau kariertes Hemd mit offenem Kragen und eine Wildlederjacke. Er war nicht mehr jung, aber auch noch nicht sonderlich alt. Nach Montys Dafürhalten sah er aus wie ein feiner Pinkel.
»Wer in drei Teufels Namen sind Sie?«, schnappte Monty. »Das hier ist ein privates Wohnhaus, Sir!«
Der Bursche antwortete nicht. Monty schob sich ein wenig näher, ohne einen gewissen Sicherheitsabstand zu unterschreiten, und musterte den Fremden eingehender.
Zu seinem Abscheu stellte er fest, dass der Bursche gesabbert hatte und der Speichel auf seinem Kinn getrocknet war. Er hatte eine silberne Spur auf der Haut hinterlassen, wie von einer Schnecke. Schlimmer noch, dem Kerl war allem Anschein nach ein übles Missgeschick passiert. Der verräterisch stinkende Fleck zwischen seinen Beinen war schon fast wieder getrocknet.
Monty rümpfte die Nase. »Wohl zu viel getrunken, was, alter Junge? Glauben Sie mir, niemand versteht das besser als ich. Trotzdem, Sie können nicht hierbleiben, wissen Sie?«
Der Fremde antwortete nicht. Monty räusperte sich laut und forderte den Fremden erneut in schroffem Ton auf, endlich aufzuwachen. Der Besucher schlummerte weiter.
Ärger gewann die Oberhand über Vorsicht. Monty packte einen Wildlederärmel und schüttelte ihn unsanft - ohne Ergebnis. Die Gestalt rührte sich nicht. Überhaupt nicht. Der Gestank nach getrocknetem Urin war durch das Schütteln stärker geworden.
Monty stieß einen langgezogenen, leisen Pfiff aus. Er warf einen Blick zur Tür und stellte erleichtert fest, dass sie offen stand und er, sollten seine Knie dies erlauben, die Flucht ergreifen konnte. Im gleichen Moment fiel ihm auch wieder ein, dass die Tür immer offen stand. Er schloss die Zimmertüren nie, weil dies lediglich bedeutete, dass er sie wieder öffnen musste, wenn er in eines der Zimmer wollte. Die Wohnzimmertür jedoch war geschlossen gewesen, definitiv geschlossen, als er nach Hause gekommen war. Er erinnerte sich deutlich, dass er sie geöffnet hatte beim Betreten des Wohnzimmers, keine fünf Minuten zuvor. Der Bursche auf seinem Sofa musste sie geschlossen haben.
Oder vielleicht auch jemand anders, nachdem er den Burschen auf Montys Sofa abgelegt hatte - denn der Kerl erweckte in Monty eine dunkle Befürchtung. Nämlich, dass er tot sein könnte. Das vollgesabberte Hemd hob und senkte sich nicht wie bei jemandem, der im Schlaf atmete. Er schien sich übergeben zu haben, und auch das Erbrochene war getrocknet.
»Hey!«, rief Monty noch einmal, ohne rechte Hoffnung auf eine Antwort.
Seine Stimme hallte ungehört durch das Zimmer. »Verdammter Mist!«, fluchte er und wich einen Schritt zurück.
Das ließ die gesamte Angelegenheit in einem gänzlich neuen Licht erscheinen. Wäre der Kerl am Leben gewesen, hätte Monty ihn rausgeworfen und ihm gesagt, dass er verschwinden solle.
Doch das ging nicht bei einem Toten, und ignorieren ließ sich so ein Toter ebenfalls nicht.
Vorsichtig schob sich Monty weiter zurück und aus dem Zimmer. Er eilte durch den Flur und in die Küche, packte ein schmutziges Glas, spülte es unter fließendem Wasser ab und kehrte damit - sehr viel langsamer jetzt - zurück ins Wohnzimmer.
Er hatte insgeheim - und ziemlich unlogisch - gehofft, dass sein Besucher auf die gleiche unerklärliche Weise verschwunden sein könnte, auf die er gekommen war. Sich in Luft aufgelöst haben könnte. Doch nein, er war immer noch da. Monty machte einen Bogen um das Sofa und ging zu seiner Whiskyflasche. Schenkte sich einen großzügigen Schluck ein und setzte sich damit auf einen Sessel gegenüber dem Leichnam, um über die Frage nachzudenken, was als Nächstes zu tun war.
Übersetzung: Axel Merz
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
... weniger
Bibliographische Angaben
- Autor: Ann Granger
- 2011, 4. Aufl., 400 Seiten, Maße: 12,5 x 18,6 cm, Taschenbuch, Deutsch
- Übersetzer: Axel Merz
- Verlag: Bastei Lübbe
- ISBN-10: 3404160738
- ISBN-13: 9783404160730
- Erscheinungsdatum: 14.09.2011
Kommentare zu "Mord hat keine Tränen / Jessica Campbell Bd.2"




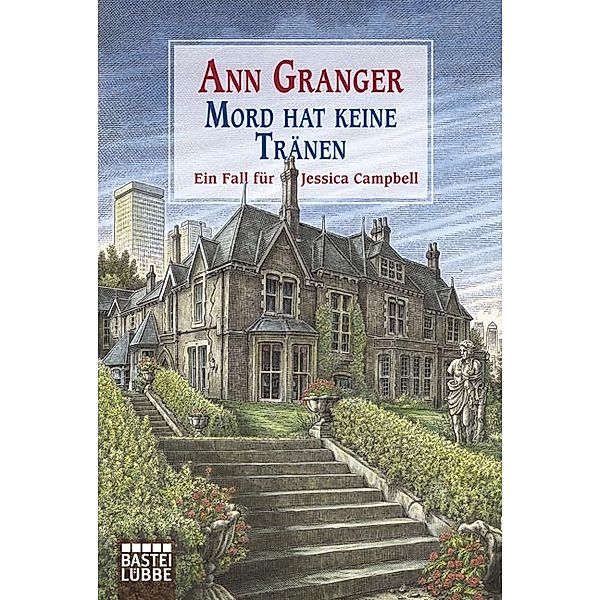

4 von 5 Sternen
5 Sterne 1Schreiben Sie einen Kommentar zu "Mord hat keine Tränen / Jessica Campbell Bd.2".
Kommentar verfassen