Nie war es herrlicher zu leben
Das geheime Tagebuch des Herzogs von Croÿ 1718-1784
Herzog Emanuel von Croÿ (1718 - 1784) stammte aus einer altadligen Familie französisch-deutschen Ursprungs, war Landbesitzer, ranghoher Militär, Beobachter und Chronist seiner Zeit und interessierte sich insbesondere für Literatur, Architektur sowie das...
lieferbar
versandkostenfrei
Buch (Gebunden)
25.70 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Nie war es herrlicher zu leben “
Klappentext zu „Nie war es herrlicher zu leben “
Herzog Emanuel von Croÿ (1718 - 1784) stammte aus einer altadligen Familie französisch-deutschen Ursprungs, war Landbesitzer, ranghoher Militär, Beobachter und Chronist seiner Zeit und interessierte sich insbesondere für Literatur, Architektur sowie das Theater. Er war nicht nur ein produktiver Autor von Essays und Pamphleten, sondern auch ein besessener Tagebuchschreiber, von dem tausende Seiten seines Journals seit 1740 überliefert sind.Hans Pleschinski hat das Journal zum ersten Mal in einer Auswahl für das deutsche Publikum übersetzt und herausgegeben: Eine farbige und anschauliche, streckenweise einzigartige Fundgrube, was das politische und gesellschaftliche, private und höfische Leben im 18. Jahrhundert in Frankreich und in Deutschland bis zur Französischen Revolution anbelangt. Begegnungen mit Voltaire und Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Hinrichtung eines Attentäters und das Sterben Ludwigs XV. - ein unschätzbares und präzises Dokument einer untergegangenen Welt.
"Ich überreichte Mr. Franklin eine Denkschrift zur Verbreitung der französischen Sprache in den Vereinigten Staaten, worüber er vor dem Kongreß zu sprechen zusagte. Er spielte auf seiner Harmonika, die er noch weiter perfektioniert hatte. Er, der Vater der Elektrizität, setzte vor unseren Augen einen starken elektrischen Apparat in Gang. Von Boston zeigte er uns Ansichten auf feinem Papier (:::) Das war alles sehr interessant. Sein Land ist wie ein Traum!"
Aus: Das geheime Tagebuch des Herzogs von Croÿ
Herzog Emanuel von Croÿ (1718-1784) stammte aus einer altadligen Familie französisch-deutschen Ursprungs, war Landbesitzer, ranghoher Militär, Beobachter und Chronist seiner Zeit und interessierte sich insbesondere für Literatur, Architektur sowie das Theater. Er war nicht nur ein produktiver Autor von Essays und Pamphleten, sondern auch ein besessener Tagebuchschreiber, von dem tausende Seiten seines Journals seit 1740 überliefert sind.
Hans Pleschinski hat das Journal zum ersten Mal in einer Auswahl für das deutsche Publikum übersetzt und herausgegeben: Eine farbige und anschauliche, streckenweise einzigartige Fundgrube, was das politische und gesellschaftliche, private und höfische Leben im 18. Jahrhundert in Frankreich und in Deutschland bis zur Französischen Revolution anbelangt. Begegnungen mit Voltaire und Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Hinrichtung eines Attentäters und das Sterben Ludwigs XV. - ein unschätzbares und präzises Dokument einer untergegangenen Welt.
'Ich überreichte Mr. Franklin eine Denkschrift zur Verbreitung der französischen Sprache in den Vereinigten Staaten, worüber er vor dem Kongreß zu sprechen zusagte. Er spielte auf seiner Harmonika, die er noch weiter perfektioniert hatte. Er, der Vater der Elektrizität, setzte vor unseren Augen einen starken elektrischen Apparat in Gang. Von Boston zeigte er uns Ansichten auf feinem Papier (...) Das war alles sehr interessant. Sein Land ist wie ein Traum!' Aus: Das geheime Tagebuch des Herzogs von Croÿ: Eine farbige und anschauliche, streckenweise einzigartige Fundgrube, was das politische und gesellschaftliche, private und höfische Leben im 18. Jahrhundert in Frankreich und in Deutschland bis zur Französischen Revolution anbelangt. Begegnungen mit Voltaire und Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Hinrichtung eines Attentäters und das Sterben Ludwigs XV. - ein unschätzbare
Hans Pleschinski hat das Journal zum ersten Mal in einer Auswahl für das deutsche Publikum übersetzt und herausgegeben: Eine farbige und anschauliche, streckenweise einzigartige Fundgrube, was das politische und gesellschaftliche, private und höfische Leben im 18. Jahrhundert in Frankreich und in Deutschland bis zur Französischen Revolution anbelangt. Begegnungen mit Voltaire und Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Hinrichtung eines Attentäters und das Sterben Ludwigs XV. - ein unschätzbares und präzises Dokument einer untergegangenen Welt.
'Ich überreichte Mr. Franklin eine Denkschrift zur Verbreitung der französischen Sprache in den Vereinigten Staaten, worüber er vor dem Kongreß zu sprechen zusagte. Er spielte auf seiner Harmonika, die er noch weiter perfektioniert hatte. Er, der Vater der Elektrizität, setzte vor unseren Augen einen starken elektrischen Apparat in Gang. Von Boston zeigte er uns Ansichten auf feinem Papier (...) Das war alles sehr interessant. Sein Land ist wie ein Traum!' Aus: Das geheime Tagebuch des Herzogs von Croÿ: Eine farbige und anschauliche, streckenweise einzigartige Fundgrube, was das politische und gesellschaftliche, private und höfische Leben im 18. Jahrhundert in Frankreich und in Deutschland bis zur Französischen Revolution anbelangt. Begegnungen mit Voltaire und Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Hinrichtung eines Attentäters und das Sterben Ludwigs XV. - ein unschätzbare
Lese-Probe zu „Nie war es herrlicher zu leben “
Nie war es herrlicher zu leben von Hans Pleschinski (Hrsg.)Das Attentat
... mehr
Am Neujahrsmorgen 1757 ging ich in die Frühmesse. Dann harrte ich im CEuil-de-Boeuf-Salon lange meines Schicksals. Schließlich wurden sieben neue Ordensritter bekanntgegeben, ich war nicht darunter. Nicht ohne Schmerz sah ich, wie M. de Broglie beglückwünscht wurde. Es handelte sich um die sieben, die ich mir notiert hatte. Sie waren zugegebenermaßen durchwegs würdig. Nur der Infant sollte erst an Lichtmeß aufgenommen werden. Alle Orden waren Botschaftern vorbehalten. Ich erblickte den Prince de Soubise, dessen Fürsprache ich zu erlangen suchte. Er riet mir, mich zu entfernen.
Ich nahm die Wahl recht ruhig auf, wiewohl sie mich weit zurückwarf, sogar hinter Jüngere. Ich kehrte nach Paris zurück, um meine Mutter zu benachrichtigen und zu trösten.
Nachdem ich am 5. Januar tagsüber gearbeitet hatte, begab ich mich um halb zehn zum Souper ins Hötel de Condé wo ich ein Jahr lang nicht gewesen war. Als ich den Salon betrat, waren alle rundum erstarrt. M. le Prince und Mme. la Princesse de Condé besprachen sich mit entsetzter Miene. Ich trat neben Mme. de Renty, die mir offenbarte: «Es gilt als sicher, daß jemand den König ermorden wollte und daß er verwundet wurde!» Mehr war nicht zu erfahren.
M. le Prince de Condé brach auf, und von überall ließ man Nachrichten einholen. Da bereits serviert wurde, setzte man sich zu Tisch. Nie verlief ein Essen bedrückter. Niemand wagte aufzublicken. Das Souper war schnell vorbei. Nach Mitternacht traf der Bericht von M. de Gesvres ein. Die hübsche, liebenswürdige und schwangere Princesse de Condé glaubte, ohnmächtig zu werden:
Als der König seine Karosse besteigen wollte, um nach Trianon aufzubrechen. wurde er rechts von einem Schlag getroffen, den er zuerst für einen Fausthieb hielt. Erfaßte mit der Hand hin und zog sie voller Blut zurück. Er selbst befahl die Verhaftung des Mannes im grauen Mantel und daß man ihn nicht töte. Noch gut bei Kräften stieg der König seine Treppe hinauf Kein Wundarzt war in der Nähe. Man entkleidete ihn. Schließlich kam La Martinière. Er untersuchte die Wunde und befand sie für weder tief noch gefährlich. Der König wurde zur Ader gelassen, und er ruht derzeit.
Der Mann wurde verhaftet.
Am 6. Januar, Heilige Drei Könige, fuhr ich nach Versailles. Auf Schritt und Tritt waren Wachen postiert. Alles befand sich in Alarmbereitschaft. Im Spiegelsaal erkundigte ich mich nach dem Befinden des Königs. Mir wurde versichert, daß die Wunde so geringfügig wie ein Degenstich sei und sich in Gesellschaft sogar verbergen lasse. Ich erfuhr die Umstände; hier nun im Groben, was ich zusammentrug: Gegen sechs Uhr abends bei nur leicht diesigem Wetter, Vollmond und Fackelschein, der ihn blendete, wollte der König nach Trianon, wo alle weilten, zurückfahren. Als er hinter dem Hauptmann der Hundert Schweizer die unterste Stufe aus dem kleinen Wachsaal nahm, um in seine Karosse zu steigen, auf seinen Ersten Großwappenträger gestützt und gefolgt vom Dauphin und dem Duc d'Ayen, stürzte ein Mann zwischen zwei Wachen, die er zur Seite drängte, hervor, schob einen Gardeoffizier beiseite, gelangte halbwegs hinter den König und stieß diesem mit solcher Kraft ein Taschenmesser in die rechte Seite, daß der König durch die Wucht des Hiebs oder wegen des Messerknaufs vornüberwankte und sagte: «Duc d'Ayen, mich hat eine Faust getroffen!»
Der Täter war so schnell, daß er durch die Lücke zwischen den Wachen, die sich gerade wieder faßten, zurückschlüpfte, und niemand hatte den Hieb gesehen, sei's wegen der Fackeln oder wegen der untersten Treppenstufe, auf die man gerade achtgegeben hatte.
Nach den Worten des Königs rief aus dem Gefolge der Marschall de Richelieu: «Wer ist der Mann da mit dem Hut?» Der König wandte sich um, spürte rechts die Wunde, faßte hin, zog die blutige Hand zurück und sagte: «Ich bin verletzt! Man verhafte ihn. Aber tötet ihn nicht!»
Ein Page, der den Wagenschlag offenhielt, rief: « Der König ist verletzt!» Man bekam den Mann zu fassen, und der König kehrte um. Man will ihn tragen. Er sagt: «Nein, ich schaffe es hinauf.» Geradezu leichtfüßig nahm er seine Treppe und wirkte bislang sicher und geistesgegenwärtig. Als er oben viel Blut rinnen sah, wähnte er, tödlich verwundet zu sein: «Er hat mich getroffen. Ich bin verloren!» Die Wunde und die Erregung schwächten ihn, und mehrmals verlangte er nach Beichtvater und Arzt. Da fast sein ganzes Gefolge in Trianon weilte, war niemand zur Hand. Sein Bett war ohne Wäsche, es gab kein Hemd. Man fand bloß einen Morgenrock. Dem König wurde übel, und er fürchtete zu sterben. Er wollte eilends seinen Beichtvater. Ein Geistlicher der Pfarrei traf ein. Hastig beichtete er und bat um die Absolution, versprach, umfassender und besser zu beichten, wenn ihm die Zeit dafür bliebe. Die Absolution wurde ihm erteilt.
Irgendein Wundarzt kam, reinigte die Wunde, wagte aber nicht, sie ohne den Ersten Chirurgen genauer zu untersuchen. Schließlich traf La Martinire aus Trianon ein. Er untersuchte die Wunde und erklärte sie weder für tief noch für gefährlich, aber man glaubte - auch der König selbst -, das Messer wäre vergiftet gewesen. Alle wurden immer besorgter. Die Prinzessinnen waren durch den Tumult alarmiert, eilten herbei und sanken, als sie den König in seinem Blut liegen sahen, ohnmächtig am Bett zusammen. Einige von ihnen, ich weiß nicht welche, blieben lange bewußtlos. Wenngleich in Tränen aufgelöst, verhielt sich der Dauphin gefaßt und sorgte für Ordnung.
Die Königin traf ein, meinte, es handele sich um eine Kolik, sah das Blut und wankte. Der König verlangte weiter nach seinem Beichtvater. Da dieser nicht da war, schlug man den angesehenen Priester der Königlichen Haushaltungen vor. Er kam. Ihm beichtete der König lange, bat dann um die Letzte Ölung. Es wurde nach den Heiligen Ölen und nach dem Kardinal de la Rochefoucauld geschickt. Die Salbgefäße kamen, doch glücklicherweise fand man den Kardinal nicht, und der König empfing keine Letzte Ölung.
Der königliche Beichtvater traf ein. Der König verbrachte mit ihm eine halbe Stunde, und man dachte, um Mme. de Pompadour wäre es nunmehr geschehen und es brächen nun wieder fromme Zeiten an. Die vertrautesten Höflinge erwogen dies und jenes, meistens nichts Ersprießliches. Der König leistete vor allen Anwesenden ehrenvoll Abbitte für seine Sünden, bat seine Kinder für erlittene Schmach und die Königin für begangenes Unrecht um Verzeihung. Zum Dauphin gewandt, sagte er, nun würde er bald glückvoller herrschen als er selbst und das Königreich in gute Hände kommen. Alle brachen in Tränen aus. Weil man Gift fürchtete, löste man gegen Mitternacht den Verband, fand aber kein bedrohliches Anzeichen und sah, daß man sich getäuscht hatte. So beruhigten sich allmählich die Gemüter.
Mme. de Pompadour befand sich mit den wichtigsten Höflingen in Trianon. Sie kehrte nach Versailles in ihr Appartement zurück, wo sie vermeintlich ruhig mehrere Tage zubrachte, ohne zum König vorgelassen zu werden.
Doch nun zum Attentäter: Sobald er ergriffen und verhört wurde, erklärte er: «Nun denn! Ich war's! Nicht nötig, noch zu suchen!» Bei seiner Tat trug er einen Hut. Als ihn zuvor jemand aufgefordert hatte, den Hut zu ziehen, hatte er geantwortet: «Nein, so trete ich den Königen entgegen!»
Man schaffte ihn in den Wachsaal. Er mußte sich völlig entkleiden. In seiner Tasche fand man ein Messer aus Namur, mit gewöhnlicher Klinge an der einen und einem Federmesser an der anderen Seite des Griffs, wie bei den Namurschen Messern üblich. Man verglich es mit dem Stich durch das Gewand des Königs und befand, daß der Mann mit diesem Messer zugestochen hatte. Man drang in ihn, ob es vergiftet gewesen sei. Er versicherte, daß nichts dergleichen zu befürchten sei, doch um sich wichtig zu machen, sagte er: «Vorsicht mit dem Dauphin!» Er wurde nach Komplizen befragt. Er antwortete: «Wenn es welche gibt, dann sind sie nicht hier!» Am meisten erstaunte, daß man bei ihm ungefähr fünfunddreißig Louis in Gold und Silber fand und eine Nummer i in seinem Hut.
Man glaubte an eine Verschwörung. Überall wurden Wachen postiert, denn alles schien denkbar. M. de Machault, Siegelbewahrer, kam hinzu, zornmütig hinter ruhigem Äußeren, und verlangte, daß man den Täter durch Feuer an den Füßen zum Reden bringen solle. Die Wachen machten die Zangen glühend und verbrannten seine Füße so heftig, daß er daran zu sterben glaubte. M. de Machault wurde dies übel angekreidet. Der Verbrecher schlug wild um sich, gab aber nichts preis. Schließlich schaffte man ihn in den Kerker von Versailles, in die Obhut des Großvogts M. de Sourches und seiner Kriminalbeamten und bewacht von der Französischen Garde.
Das alles geschah in der ersten Nacht.
[...]
Nachdem ich am 6. morgens in Versailles eingetroffen war und mich im CEuil-de-Beeuf-Salon, wo sich die meisten aufhielten, über die Geschehnisse ins Bild gesetzt hatte, erfuhr ich, daß M. d'Argenson mich suchte. Ich begab mich zum Minister und erwähnte, daß der Täter offenbar aus Arras stamme. Er dankte für diesen Hinweis und bestimmte, daß ich sofort nach Arras aufbrechen solle, um den Hintergrund des Attentats aufzuklären. Ich sagte, daß ich zuerst den Verbrecher sehen müsse, um Anhaltspunkte zu bekommen. Er stimmte zu, lobte mich und schickte mich zu M. de Sourches, damit ich den Mann sehen konnte. M. de Sourches, der es begrüßte, daß ich nach Arras reisen sollte, führte mich zum Kerker, wo seine Beamten ihre Verhöre durchführten. Er ließ mich den Täter sehen, einen recht schönen Mann mit tiefliegenden Augen, großer Nase und von den Brandqualen fiebriger Gesichtsfarbe. Er lag auf eine Pritsche gekettet, litt und beklagte sich über M. de Machault, der ihn sinnlos mit glühenden Eisen habe quälen lassen.
Ich fragte ihn, ob er aus dem Artois stamme. Er sagte: «Ja, das stimmt! Und Leute aus dem Artois sind keine Geheimniskrämer. Wir haben keine Angst. Der König hat keine besseren Untertanen!» Alles übrige solle ich M. de Sourches fragen. Seine Stimme klang sanft, was mich zuerst in die Irre führte, denn ich hielt ihn für jemanden aus guter Familie. Beim Hinausgehen dankte er uns und sagte, daß er nur noch Gott und einen guten Beichtvater brauche. Ich begriff, daß er ein Fanatiker war und sonst nichts.
[...]
Am 9. traf ich um sechs Uhr bei M. de Fillancourt in Arras ein. Ich fand alle Personen vor, die ich hatte einbestellen lassen. Ich ließ die Vorgeladenen erzittern! Der Raum war gedrängt voll. Ich ging ins Nebenzimmer und sprach mit jedem Amtsträger. Ich merkte, daß ihre Nachforschungen nichts taugten. Ich fragte nach den beiden Kronanwälten. Ich erfuhr, was ich bereits vom Täter erfahren hatte. Ich ahnte, daß man hierzulande wohl keinerlei Mitschuld trug. Gemäß den Protokollangaben ließ ich jeden, der etwas wissen konnte, zu mir kommen. Darunter befand sich Réant, der mir einen Schrecken einjagte, als er « Alculoy » genauso aussprach, wie ich es vom Täter gehört hatte.' Die Verhöre und Akten bewiesen die Besessenheit des Täters. Ich hielt die Auskünfte ordnungsgemäß fest. M. de Goure, stellvertretender Intendant der Provinz, unterstützte mich nach Kräften. Nachdem die Befragungen bis zehn Uhr gedauert hatten, aß ich gut zu Abend. Ich nahm das Mal sehr gemessen ein, unterstrich dadurch den finsteren Anlaß und ließ die Amtsträger spüren, welche Schmach es war, daß ihr Land ein solches Ungeheuer hervorgebracht hatte.
Ich erfuhr, daß die drei Brüder Ferrand oder Fillancourt auf Betreiben der Marquise hier Posten bekleideten und durchaus beliebt waren.
Mittwoch, den 12., empfing ich etliche Amtspersonen und fuhr mit meinen Nachforschungen über die Gegend und Dörfer fort. Ich speiste beim Comte du Cécile.
Donnerstag, den 13., wurden die Untersuchungen fortgesetzt, überdies empfing ich einige Damen. Ich speiste bei M. de Fillancourt. Ich wies die Vertreter der Stände (nach einer zufälligen Bemerkung) darauf hin, daß sie offenbar schliefen, und drängte auf eine Sonderversammlung, um eine Sondergesandtschaft an den Hof zu beschließen. Ich unterrichtete den Comte de Guines davon und feuerte die Herren an. Ich erfuhr, daß man den Vater in Saint-Omer verhaftet hatte, und wollte alsbald dorthin. Mein Kurier traf mit den erfreulichsten und schmeichelhaftesten Briefen aus Versailles ein.
Als ich Samstag, den 15., um acht Uhr früh aufbrechen wollte, erfuhr ich, daß die Familie zu mir gebracht wurde. Ich ließ den Gendarmen und den Kommissar holen. Gespräch mit ihnen. Ich sah verstohlen nach dem Vater vor der Tür. Ich ließ die Aussagen von Vater und Bruder, die nur von einem Diebstahl wußten, protokollieren. Ich empfand Mitleid mit den beiden in Ketten, zumal sie ehrbar wirkten.
22., Verhör der Bewohner von Fiefs und sonstiger Landsleute.
Den 4. März empfing ich von zehn bis mittags die wichtigsten Personen von Arras und den Bischof. Mit Genugtuung spürte ich, wie sehr ich wegen meiner Pflichterfüllung geschätzt wurde. Und es schmeichelte mir zu erfahren, daß das Parlament mir so vollständig vertraute und mit meiner Arbeit dermaßen zufrieden war, daß es sich bei seinem Prozeß vollkommen darauf stützen wollte. Also hatte ich in sehr stürmischen Zeiten zugleich das Parlament und das Artois zufriedengestellt. Ich nahm schweren Herzens Abschied und erreichte am 5. bei Einbruch der Nacht Paris.
Beim Obersten Parlamentspräsidenten fanden sich drei Kommissare ein, M. Severt und seitens des Königs die beiden Messieurs de Fleury. Ich nahm feierlich Platz, und in aller Form begann die Sitzung. Ich war meiner Sache keineswegs unsicher, sondern ließ es eher die anderen werden. Ich berichtete von meinem Vorgehen und legte den Charakter Damiens' dar, so wie er sich mir durch eine Vielzahl von Informationen erschlossen hatte. Daß er von galligem Blut und Wesen, bösartig und gefährlich seit Kindesbeinen war, hochmütig und eingebildet, und daß er sich dazu ausersehen fühlte, gebieterisch Ordnung zu stiften. Daß er keine moralischen Grundsätze kannte, Geistliche verachtete und über den Glauben gespottet hatte, finster und verschlossen war, sich nie jemandem öffnete, daß er laute Selbstgespräche führte oder in sich hineinmurmelte und von derartig aufbrausendem Blut war, daß nur der Aderlaß half. Alle zwei Wochen hatte er sich zur Ader lassen und Opium nehmen müssen, was ihn für vier, fünf Tage besänftigte, wonach dann aber sein Wahn, den König töten zu müssen, wieder Besitz von ihm ergriffen und sich mit seinen Blutwallungen gesteigert hatte.
Ich endete mit meiner Einschätzung, daß vier Ursachen den Elenden angetrieben hatten: 1. sein ungestümes Blut und seine Geburt in Armut, 2. fehlende Moral und ein ihm eher spaßeshalber gestelltes Horoskop, 3. lästerliche Reden in seiner Gegenwart, 4. die wichtigste Ursache: der übermäßige und verzehrende Hochmut, der ihn glauben ließ, er müsse sich für das allgemeine Wohl und die Ordnung im Staate opfern. Das hatte den Verrückten, der er in diesem Punkte war, geleitet.
[...]
Der 28. März war sein Schreckenstag, an dem er die furchtbarsten vierzehn Stunden durchstand. Um vier Uhr früh wurde ihm sein Urteil verlesen. Er war von nichts überrascht, wußte längst alles, und sein Hochmut verleitete ihn dazu, seine Richter zu fragen, ob sie etwas vergessen hätten. Um sieben Uhr wurde er noch einmal verhört und überstand übel zugerichtet die peinliche und hochnotpeinliche Folter. Schon davor hatte er beharrlich beteuert, keinen Komplizen zu haben oder nennen zu können, und versuchte, sich so gut wie möglich an alles zu erinnern. Zuletzt entsann er sich, daß ein Sekretär in einem Haus, in dem er vor ungefähr vier Jahren gedient hatte, hinsichtlich eines Schreckens, der dem König widerfahren war, gemeint habe: Vielleicht müsse man dem König Angst einjagen, damit er wieder zur Besinnung komme. Und daß er, Damiens, diese Bemerkung nicht vergessen, sondern gegrübelt habe, wie er den König treffen könne, damit er in sich ging, und wie mutig und entschlossen er sich gefühlt habe, sich dafür zu opfern. Das schien wirklich sein ganzer Plan gewesen zu sein, der von hetzerischen Reden in Paris genährt und durch sein ungestümes Blut zur Tat geworden war. So war es denn.
Gegen drei Uhr nachmittags wurde er nach Notre-Dame gekarrt, um Abbitte zu leisten. Von dort vor vier zum Grève-Platz. Wo er vorbeikam, drängten sich die Menschenmassen, aber das Pariser Volk schien wie üblich nur gleichgültig zu gaffen. Weder Haß noch Mitleid waren zu spüren.
Als er am Grève-Platz ankam, musterte er alles. Er wurde ins Rathaus geführt, wo er sich eine halbe Stunde lang aufhielt. Dort bekannte er, daß er Gott, den König, das Gericht und den Erzbischof für all seine lästerlichen Reden um Vergebung bitte. Er versicherte abermals, daß es weder eine «Verschwörung noch einen Komplizen» gebe. Dann verstummte er und wollte seine Bestrafung nicht länger hinauszögern, sondern hinter sich bringen.
Gegen halb fünf wurde er in die Mitte des Grève-Platzes geführt, wo dicke Schranken ungefähr einen halben Morgen aussparten, in dessen Mitte eine Art niedriger Tisch aufgebaut war, der fest auf sechs großen Steinen ruhte.
Um ihn herum befanden sich nur die sechs Henker und zwei Beichtväter. Er half selbst, sich zu entkleiden, und zeigte weder Furcht noch Befremden, sondern schien begierig, zum Ende zu kommen (man wird sich daran erinnern, daß er sich oft genug selbst töten wollte). Man streckte ihn auf diesem Tisch aus, wo Eisenreifen seinen Körper in jede Richtung umklammerten, zwei quer über die Brust, einer teilte sich gabelförmig und ließ den Hals frei, einer drückte die Schenkel nieder. Alle waren längs miteinander verbunden und wurden durch große Schrauben unter dem Tisch gespannt, so daß der Rumpf vollkommen unbeweglich lag. Ein besonderes Eisen wurde um seine rechte Hand geschlossen, man verbrannte sie ihm mit Schwefelfeuer, was ihn schreckliche Schreie ausstoßen ließ, dann wurden seine Arme und Beine straff gefesselt, zuerst oben und dann bis hinunter zu Handgelenk und Fuß, und man befestigte diese Seile am Zuggeschirr der vier schweren Pferde, die an den vier Ecken des Tisches aufgestellt waren. Nachdem der Henker das Zeichen gegeben hatte, ließ man die Pferde immer wieder stoßweise anziehen, was nichts bewirkte, sondern ihn nur grauenvoll brüllen ließ. Man trieb die Pferde doppelt so kräftig an, ohne ihn zerreißen zu können. Seine grauenvollen Schreie übertönten trotz des Lärms der gewaltigen Zuschauermenge alles. So zogen die Pferde eine Stunde lang an ihm, ohne etwas auszurichten.
Um ihn zerreißen zu können, spannte man für seine Schenkel zusätzlich die zwei Karrenpferde an, zog, trieb alle sechs Pferde auf einmal. Das verdoppelte nur sein Brüllen, das - denn so stark war dieser Mann - nicht leiser werden wollte. Die Henker, die sich nicht mehr zu helfen wußten, gingen im Rathaus nachfragen. Man beschied ihnen, daß er gevierteilt werden müsse. Man begann wieder mit dem stoßweisen Zerren der Pferde. Die Schreie verstummten nicht, aber die Pferde begannen von ihrem Stampfen auf der Stelle müde zu werden. Daraufhin erlaubten die Richter, daß man ihn in Stücke haue; ein Henker hieb in den Schenkel und ließ zugleich die Pferde ziehen. Damiens hob noch den Kopf, um zu sehen, was man mit ihm mache, und er, der Gotteslästerer, stieß keine Flüche aus, sondern wendete seinen Kopf immer wieder zum Kruzifix und küßte es. Die Beichtväter redeten auf ihn ein.
Schließlich, nach anderthalb Stunden dieser durch ihre Dauer beispiellosen Qualen, riß zuerst der linke Schenkel ab. Das Volk klatschte Beifall. Bis dahin schien es nur gleichmütig neugierig gewesen zu sein. Dann riß, durch das Hineinhacken, der andere Schenkel ab. Darauf hieb man in eine Schulter, die schließlich abgetrennt wurde. Das Schreien verstummte nicht, war aber viel schwächer geworden. Der Kopf bewegte sich noch. Dann hackte man den vierten Teil ab, das heißt die andere Schulter. Der Kopf starb erst, als auch er abgeschlagen war und nur noch der Rumpf eingespannt lag. Man löste die Eisenringe, und es heißt, daß der Leib noch gezuckt habe, als man ihn auf den Scheiterhaufen warf, wo alle Teile verbrannt wurden.
So war das Ende dieses Elenden, der durch die Dauer seiner großen Qualen die gewiß furchtbarste Strafe erlitt, die je ein Mensch erdulden mußte.
[...]
Übersetzung: Hans Pleschinski
© Verlag C.H.Beck oHG, München
Am Neujahrsmorgen 1757 ging ich in die Frühmesse. Dann harrte ich im CEuil-de-Boeuf-Salon lange meines Schicksals. Schließlich wurden sieben neue Ordensritter bekanntgegeben, ich war nicht darunter. Nicht ohne Schmerz sah ich, wie M. de Broglie beglückwünscht wurde. Es handelte sich um die sieben, die ich mir notiert hatte. Sie waren zugegebenermaßen durchwegs würdig. Nur der Infant sollte erst an Lichtmeß aufgenommen werden. Alle Orden waren Botschaftern vorbehalten. Ich erblickte den Prince de Soubise, dessen Fürsprache ich zu erlangen suchte. Er riet mir, mich zu entfernen.
Ich nahm die Wahl recht ruhig auf, wiewohl sie mich weit zurückwarf, sogar hinter Jüngere. Ich kehrte nach Paris zurück, um meine Mutter zu benachrichtigen und zu trösten.
Nachdem ich am 5. Januar tagsüber gearbeitet hatte, begab ich mich um halb zehn zum Souper ins Hötel de Condé wo ich ein Jahr lang nicht gewesen war. Als ich den Salon betrat, waren alle rundum erstarrt. M. le Prince und Mme. la Princesse de Condé besprachen sich mit entsetzter Miene. Ich trat neben Mme. de Renty, die mir offenbarte: «Es gilt als sicher, daß jemand den König ermorden wollte und daß er verwundet wurde!» Mehr war nicht zu erfahren.
M. le Prince de Condé brach auf, und von überall ließ man Nachrichten einholen. Da bereits serviert wurde, setzte man sich zu Tisch. Nie verlief ein Essen bedrückter. Niemand wagte aufzublicken. Das Souper war schnell vorbei. Nach Mitternacht traf der Bericht von M. de Gesvres ein. Die hübsche, liebenswürdige und schwangere Princesse de Condé glaubte, ohnmächtig zu werden:
Als der König seine Karosse besteigen wollte, um nach Trianon aufzubrechen. wurde er rechts von einem Schlag getroffen, den er zuerst für einen Fausthieb hielt. Erfaßte mit der Hand hin und zog sie voller Blut zurück. Er selbst befahl die Verhaftung des Mannes im grauen Mantel und daß man ihn nicht töte. Noch gut bei Kräften stieg der König seine Treppe hinauf Kein Wundarzt war in der Nähe. Man entkleidete ihn. Schließlich kam La Martinière. Er untersuchte die Wunde und befand sie für weder tief noch gefährlich. Der König wurde zur Ader gelassen, und er ruht derzeit.
Der Mann wurde verhaftet.
Am 6. Januar, Heilige Drei Könige, fuhr ich nach Versailles. Auf Schritt und Tritt waren Wachen postiert. Alles befand sich in Alarmbereitschaft. Im Spiegelsaal erkundigte ich mich nach dem Befinden des Königs. Mir wurde versichert, daß die Wunde so geringfügig wie ein Degenstich sei und sich in Gesellschaft sogar verbergen lasse. Ich erfuhr die Umstände; hier nun im Groben, was ich zusammentrug: Gegen sechs Uhr abends bei nur leicht diesigem Wetter, Vollmond und Fackelschein, der ihn blendete, wollte der König nach Trianon, wo alle weilten, zurückfahren. Als er hinter dem Hauptmann der Hundert Schweizer die unterste Stufe aus dem kleinen Wachsaal nahm, um in seine Karosse zu steigen, auf seinen Ersten Großwappenträger gestützt und gefolgt vom Dauphin und dem Duc d'Ayen, stürzte ein Mann zwischen zwei Wachen, die er zur Seite drängte, hervor, schob einen Gardeoffizier beiseite, gelangte halbwegs hinter den König und stieß diesem mit solcher Kraft ein Taschenmesser in die rechte Seite, daß der König durch die Wucht des Hiebs oder wegen des Messerknaufs vornüberwankte und sagte: «Duc d'Ayen, mich hat eine Faust getroffen!»
Der Täter war so schnell, daß er durch die Lücke zwischen den Wachen, die sich gerade wieder faßten, zurückschlüpfte, und niemand hatte den Hieb gesehen, sei's wegen der Fackeln oder wegen der untersten Treppenstufe, auf die man gerade achtgegeben hatte.
Nach den Worten des Königs rief aus dem Gefolge der Marschall de Richelieu: «Wer ist der Mann da mit dem Hut?» Der König wandte sich um, spürte rechts die Wunde, faßte hin, zog die blutige Hand zurück und sagte: «Ich bin verletzt! Man verhafte ihn. Aber tötet ihn nicht!»
Ein Page, der den Wagenschlag offenhielt, rief: « Der König ist verletzt!» Man bekam den Mann zu fassen, und der König kehrte um. Man will ihn tragen. Er sagt: «Nein, ich schaffe es hinauf.» Geradezu leichtfüßig nahm er seine Treppe und wirkte bislang sicher und geistesgegenwärtig. Als er oben viel Blut rinnen sah, wähnte er, tödlich verwundet zu sein: «Er hat mich getroffen. Ich bin verloren!» Die Wunde und die Erregung schwächten ihn, und mehrmals verlangte er nach Beichtvater und Arzt. Da fast sein ganzes Gefolge in Trianon weilte, war niemand zur Hand. Sein Bett war ohne Wäsche, es gab kein Hemd. Man fand bloß einen Morgenrock. Dem König wurde übel, und er fürchtete zu sterben. Er wollte eilends seinen Beichtvater. Ein Geistlicher der Pfarrei traf ein. Hastig beichtete er und bat um die Absolution, versprach, umfassender und besser zu beichten, wenn ihm die Zeit dafür bliebe. Die Absolution wurde ihm erteilt.
Irgendein Wundarzt kam, reinigte die Wunde, wagte aber nicht, sie ohne den Ersten Chirurgen genauer zu untersuchen. Schließlich traf La Martinire aus Trianon ein. Er untersuchte die Wunde und erklärte sie weder für tief noch für gefährlich, aber man glaubte - auch der König selbst -, das Messer wäre vergiftet gewesen. Alle wurden immer besorgter. Die Prinzessinnen waren durch den Tumult alarmiert, eilten herbei und sanken, als sie den König in seinem Blut liegen sahen, ohnmächtig am Bett zusammen. Einige von ihnen, ich weiß nicht welche, blieben lange bewußtlos. Wenngleich in Tränen aufgelöst, verhielt sich der Dauphin gefaßt und sorgte für Ordnung.
Die Königin traf ein, meinte, es handele sich um eine Kolik, sah das Blut und wankte. Der König verlangte weiter nach seinem Beichtvater. Da dieser nicht da war, schlug man den angesehenen Priester der Königlichen Haushaltungen vor. Er kam. Ihm beichtete der König lange, bat dann um die Letzte Ölung. Es wurde nach den Heiligen Ölen und nach dem Kardinal de la Rochefoucauld geschickt. Die Salbgefäße kamen, doch glücklicherweise fand man den Kardinal nicht, und der König empfing keine Letzte Ölung.
Der königliche Beichtvater traf ein. Der König verbrachte mit ihm eine halbe Stunde, und man dachte, um Mme. de Pompadour wäre es nunmehr geschehen und es brächen nun wieder fromme Zeiten an. Die vertrautesten Höflinge erwogen dies und jenes, meistens nichts Ersprießliches. Der König leistete vor allen Anwesenden ehrenvoll Abbitte für seine Sünden, bat seine Kinder für erlittene Schmach und die Königin für begangenes Unrecht um Verzeihung. Zum Dauphin gewandt, sagte er, nun würde er bald glückvoller herrschen als er selbst und das Königreich in gute Hände kommen. Alle brachen in Tränen aus. Weil man Gift fürchtete, löste man gegen Mitternacht den Verband, fand aber kein bedrohliches Anzeichen und sah, daß man sich getäuscht hatte. So beruhigten sich allmählich die Gemüter.
Mme. de Pompadour befand sich mit den wichtigsten Höflingen in Trianon. Sie kehrte nach Versailles in ihr Appartement zurück, wo sie vermeintlich ruhig mehrere Tage zubrachte, ohne zum König vorgelassen zu werden.
Doch nun zum Attentäter: Sobald er ergriffen und verhört wurde, erklärte er: «Nun denn! Ich war's! Nicht nötig, noch zu suchen!» Bei seiner Tat trug er einen Hut. Als ihn zuvor jemand aufgefordert hatte, den Hut zu ziehen, hatte er geantwortet: «Nein, so trete ich den Königen entgegen!»
Man schaffte ihn in den Wachsaal. Er mußte sich völlig entkleiden. In seiner Tasche fand man ein Messer aus Namur, mit gewöhnlicher Klinge an der einen und einem Federmesser an der anderen Seite des Griffs, wie bei den Namurschen Messern üblich. Man verglich es mit dem Stich durch das Gewand des Königs und befand, daß der Mann mit diesem Messer zugestochen hatte. Man drang in ihn, ob es vergiftet gewesen sei. Er versicherte, daß nichts dergleichen zu befürchten sei, doch um sich wichtig zu machen, sagte er: «Vorsicht mit dem Dauphin!» Er wurde nach Komplizen befragt. Er antwortete: «Wenn es welche gibt, dann sind sie nicht hier!» Am meisten erstaunte, daß man bei ihm ungefähr fünfunddreißig Louis in Gold und Silber fand und eine Nummer i in seinem Hut.
Man glaubte an eine Verschwörung. Überall wurden Wachen postiert, denn alles schien denkbar. M. de Machault, Siegelbewahrer, kam hinzu, zornmütig hinter ruhigem Äußeren, und verlangte, daß man den Täter durch Feuer an den Füßen zum Reden bringen solle. Die Wachen machten die Zangen glühend und verbrannten seine Füße so heftig, daß er daran zu sterben glaubte. M. de Machault wurde dies übel angekreidet. Der Verbrecher schlug wild um sich, gab aber nichts preis. Schließlich schaffte man ihn in den Kerker von Versailles, in die Obhut des Großvogts M. de Sourches und seiner Kriminalbeamten und bewacht von der Französischen Garde.
Das alles geschah in der ersten Nacht.
[...]
Nachdem ich am 6. morgens in Versailles eingetroffen war und mich im CEuil-de-Beeuf-Salon, wo sich die meisten aufhielten, über die Geschehnisse ins Bild gesetzt hatte, erfuhr ich, daß M. d'Argenson mich suchte. Ich begab mich zum Minister und erwähnte, daß der Täter offenbar aus Arras stamme. Er dankte für diesen Hinweis und bestimmte, daß ich sofort nach Arras aufbrechen solle, um den Hintergrund des Attentats aufzuklären. Ich sagte, daß ich zuerst den Verbrecher sehen müsse, um Anhaltspunkte zu bekommen. Er stimmte zu, lobte mich und schickte mich zu M. de Sourches, damit ich den Mann sehen konnte. M. de Sourches, der es begrüßte, daß ich nach Arras reisen sollte, führte mich zum Kerker, wo seine Beamten ihre Verhöre durchführten. Er ließ mich den Täter sehen, einen recht schönen Mann mit tiefliegenden Augen, großer Nase und von den Brandqualen fiebriger Gesichtsfarbe. Er lag auf eine Pritsche gekettet, litt und beklagte sich über M. de Machault, der ihn sinnlos mit glühenden Eisen habe quälen lassen.
Ich fragte ihn, ob er aus dem Artois stamme. Er sagte: «Ja, das stimmt! Und Leute aus dem Artois sind keine Geheimniskrämer. Wir haben keine Angst. Der König hat keine besseren Untertanen!» Alles übrige solle ich M. de Sourches fragen. Seine Stimme klang sanft, was mich zuerst in die Irre führte, denn ich hielt ihn für jemanden aus guter Familie. Beim Hinausgehen dankte er uns und sagte, daß er nur noch Gott und einen guten Beichtvater brauche. Ich begriff, daß er ein Fanatiker war und sonst nichts.
[...]
Am 9. traf ich um sechs Uhr bei M. de Fillancourt in Arras ein. Ich fand alle Personen vor, die ich hatte einbestellen lassen. Ich ließ die Vorgeladenen erzittern! Der Raum war gedrängt voll. Ich ging ins Nebenzimmer und sprach mit jedem Amtsträger. Ich merkte, daß ihre Nachforschungen nichts taugten. Ich fragte nach den beiden Kronanwälten. Ich erfuhr, was ich bereits vom Täter erfahren hatte. Ich ahnte, daß man hierzulande wohl keinerlei Mitschuld trug. Gemäß den Protokollangaben ließ ich jeden, der etwas wissen konnte, zu mir kommen. Darunter befand sich Réant, der mir einen Schrecken einjagte, als er « Alculoy » genauso aussprach, wie ich es vom Täter gehört hatte.' Die Verhöre und Akten bewiesen die Besessenheit des Täters. Ich hielt die Auskünfte ordnungsgemäß fest. M. de Goure, stellvertretender Intendant der Provinz, unterstützte mich nach Kräften. Nachdem die Befragungen bis zehn Uhr gedauert hatten, aß ich gut zu Abend. Ich nahm das Mal sehr gemessen ein, unterstrich dadurch den finsteren Anlaß und ließ die Amtsträger spüren, welche Schmach es war, daß ihr Land ein solches Ungeheuer hervorgebracht hatte.
Ich erfuhr, daß die drei Brüder Ferrand oder Fillancourt auf Betreiben der Marquise hier Posten bekleideten und durchaus beliebt waren.
Mittwoch, den 12., empfing ich etliche Amtspersonen und fuhr mit meinen Nachforschungen über die Gegend und Dörfer fort. Ich speiste beim Comte du Cécile.
Donnerstag, den 13., wurden die Untersuchungen fortgesetzt, überdies empfing ich einige Damen. Ich speiste bei M. de Fillancourt. Ich wies die Vertreter der Stände (nach einer zufälligen Bemerkung) darauf hin, daß sie offenbar schliefen, und drängte auf eine Sonderversammlung, um eine Sondergesandtschaft an den Hof zu beschließen. Ich unterrichtete den Comte de Guines davon und feuerte die Herren an. Ich erfuhr, daß man den Vater in Saint-Omer verhaftet hatte, und wollte alsbald dorthin. Mein Kurier traf mit den erfreulichsten und schmeichelhaftesten Briefen aus Versailles ein.
Als ich Samstag, den 15., um acht Uhr früh aufbrechen wollte, erfuhr ich, daß die Familie zu mir gebracht wurde. Ich ließ den Gendarmen und den Kommissar holen. Gespräch mit ihnen. Ich sah verstohlen nach dem Vater vor der Tür. Ich ließ die Aussagen von Vater und Bruder, die nur von einem Diebstahl wußten, protokollieren. Ich empfand Mitleid mit den beiden in Ketten, zumal sie ehrbar wirkten.
22., Verhör der Bewohner von Fiefs und sonstiger Landsleute.
Den 4. März empfing ich von zehn bis mittags die wichtigsten Personen von Arras und den Bischof. Mit Genugtuung spürte ich, wie sehr ich wegen meiner Pflichterfüllung geschätzt wurde. Und es schmeichelte mir zu erfahren, daß das Parlament mir so vollständig vertraute und mit meiner Arbeit dermaßen zufrieden war, daß es sich bei seinem Prozeß vollkommen darauf stützen wollte. Also hatte ich in sehr stürmischen Zeiten zugleich das Parlament und das Artois zufriedengestellt. Ich nahm schweren Herzens Abschied und erreichte am 5. bei Einbruch der Nacht Paris.
Beim Obersten Parlamentspräsidenten fanden sich drei Kommissare ein, M. Severt und seitens des Königs die beiden Messieurs de Fleury. Ich nahm feierlich Platz, und in aller Form begann die Sitzung. Ich war meiner Sache keineswegs unsicher, sondern ließ es eher die anderen werden. Ich berichtete von meinem Vorgehen und legte den Charakter Damiens' dar, so wie er sich mir durch eine Vielzahl von Informationen erschlossen hatte. Daß er von galligem Blut und Wesen, bösartig und gefährlich seit Kindesbeinen war, hochmütig und eingebildet, und daß er sich dazu ausersehen fühlte, gebieterisch Ordnung zu stiften. Daß er keine moralischen Grundsätze kannte, Geistliche verachtete und über den Glauben gespottet hatte, finster und verschlossen war, sich nie jemandem öffnete, daß er laute Selbstgespräche führte oder in sich hineinmurmelte und von derartig aufbrausendem Blut war, daß nur der Aderlaß half. Alle zwei Wochen hatte er sich zur Ader lassen und Opium nehmen müssen, was ihn für vier, fünf Tage besänftigte, wonach dann aber sein Wahn, den König töten zu müssen, wieder Besitz von ihm ergriffen und sich mit seinen Blutwallungen gesteigert hatte.
Ich endete mit meiner Einschätzung, daß vier Ursachen den Elenden angetrieben hatten: 1. sein ungestümes Blut und seine Geburt in Armut, 2. fehlende Moral und ein ihm eher spaßeshalber gestelltes Horoskop, 3. lästerliche Reden in seiner Gegenwart, 4. die wichtigste Ursache: der übermäßige und verzehrende Hochmut, der ihn glauben ließ, er müsse sich für das allgemeine Wohl und die Ordnung im Staate opfern. Das hatte den Verrückten, der er in diesem Punkte war, geleitet.
[...]
Der 28. März war sein Schreckenstag, an dem er die furchtbarsten vierzehn Stunden durchstand. Um vier Uhr früh wurde ihm sein Urteil verlesen. Er war von nichts überrascht, wußte längst alles, und sein Hochmut verleitete ihn dazu, seine Richter zu fragen, ob sie etwas vergessen hätten. Um sieben Uhr wurde er noch einmal verhört und überstand übel zugerichtet die peinliche und hochnotpeinliche Folter. Schon davor hatte er beharrlich beteuert, keinen Komplizen zu haben oder nennen zu können, und versuchte, sich so gut wie möglich an alles zu erinnern. Zuletzt entsann er sich, daß ein Sekretär in einem Haus, in dem er vor ungefähr vier Jahren gedient hatte, hinsichtlich eines Schreckens, der dem König widerfahren war, gemeint habe: Vielleicht müsse man dem König Angst einjagen, damit er wieder zur Besinnung komme. Und daß er, Damiens, diese Bemerkung nicht vergessen, sondern gegrübelt habe, wie er den König treffen könne, damit er in sich ging, und wie mutig und entschlossen er sich gefühlt habe, sich dafür zu opfern. Das schien wirklich sein ganzer Plan gewesen zu sein, der von hetzerischen Reden in Paris genährt und durch sein ungestümes Blut zur Tat geworden war. So war es denn.
Gegen drei Uhr nachmittags wurde er nach Notre-Dame gekarrt, um Abbitte zu leisten. Von dort vor vier zum Grève-Platz. Wo er vorbeikam, drängten sich die Menschenmassen, aber das Pariser Volk schien wie üblich nur gleichgültig zu gaffen. Weder Haß noch Mitleid waren zu spüren.
Als er am Grève-Platz ankam, musterte er alles. Er wurde ins Rathaus geführt, wo er sich eine halbe Stunde lang aufhielt. Dort bekannte er, daß er Gott, den König, das Gericht und den Erzbischof für all seine lästerlichen Reden um Vergebung bitte. Er versicherte abermals, daß es weder eine «Verschwörung noch einen Komplizen» gebe. Dann verstummte er und wollte seine Bestrafung nicht länger hinauszögern, sondern hinter sich bringen.
Gegen halb fünf wurde er in die Mitte des Grève-Platzes geführt, wo dicke Schranken ungefähr einen halben Morgen aussparten, in dessen Mitte eine Art niedriger Tisch aufgebaut war, der fest auf sechs großen Steinen ruhte.
Um ihn herum befanden sich nur die sechs Henker und zwei Beichtväter. Er half selbst, sich zu entkleiden, und zeigte weder Furcht noch Befremden, sondern schien begierig, zum Ende zu kommen (man wird sich daran erinnern, daß er sich oft genug selbst töten wollte). Man streckte ihn auf diesem Tisch aus, wo Eisenreifen seinen Körper in jede Richtung umklammerten, zwei quer über die Brust, einer teilte sich gabelförmig und ließ den Hals frei, einer drückte die Schenkel nieder. Alle waren längs miteinander verbunden und wurden durch große Schrauben unter dem Tisch gespannt, so daß der Rumpf vollkommen unbeweglich lag. Ein besonderes Eisen wurde um seine rechte Hand geschlossen, man verbrannte sie ihm mit Schwefelfeuer, was ihn schreckliche Schreie ausstoßen ließ, dann wurden seine Arme und Beine straff gefesselt, zuerst oben und dann bis hinunter zu Handgelenk und Fuß, und man befestigte diese Seile am Zuggeschirr der vier schweren Pferde, die an den vier Ecken des Tisches aufgestellt waren. Nachdem der Henker das Zeichen gegeben hatte, ließ man die Pferde immer wieder stoßweise anziehen, was nichts bewirkte, sondern ihn nur grauenvoll brüllen ließ. Man trieb die Pferde doppelt so kräftig an, ohne ihn zerreißen zu können. Seine grauenvollen Schreie übertönten trotz des Lärms der gewaltigen Zuschauermenge alles. So zogen die Pferde eine Stunde lang an ihm, ohne etwas auszurichten.
Um ihn zerreißen zu können, spannte man für seine Schenkel zusätzlich die zwei Karrenpferde an, zog, trieb alle sechs Pferde auf einmal. Das verdoppelte nur sein Brüllen, das - denn so stark war dieser Mann - nicht leiser werden wollte. Die Henker, die sich nicht mehr zu helfen wußten, gingen im Rathaus nachfragen. Man beschied ihnen, daß er gevierteilt werden müsse. Man begann wieder mit dem stoßweisen Zerren der Pferde. Die Schreie verstummten nicht, aber die Pferde begannen von ihrem Stampfen auf der Stelle müde zu werden. Daraufhin erlaubten die Richter, daß man ihn in Stücke haue; ein Henker hieb in den Schenkel und ließ zugleich die Pferde ziehen. Damiens hob noch den Kopf, um zu sehen, was man mit ihm mache, und er, der Gotteslästerer, stieß keine Flüche aus, sondern wendete seinen Kopf immer wieder zum Kruzifix und küßte es. Die Beichtväter redeten auf ihn ein.
Schließlich, nach anderthalb Stunden dieser durch ihre Dauer beispiellosen Qualen, riß zuerst der linke Schenkel ab. Das Volk klatschte Beifall. Bis dahin schien es nur gleichmütig neugierig gewesen zu sein. Dann riß, durch das Hineinhacken, der andere Schenkel ab. Darauf hieb man in eine Schulter, die schließlich abgetrennt wurde. Das Schreien verstummte nicht, war aber viel schwächer geworden. Der Kopf bewegte sich noch. Dann hackte man den vierten Teil ab, das heißt die andere Schulter. Der Kopf starb erst, als auch er abgeschlagen war und nur noch der Rumpf eingespannt lag. Man löste die Eisenringe, und es heißt, daß der Leib noch gezuckt habe, als man ihn auf den Scheiterhaufen warf, wo alle Teile verbrannt wurden.
So war das Ende dieses Elenden, der durch die Dauer seiner großen Qualen die gewiß furchtbarste Strafe erlitt, die je ein Mensch erdulden mußte.
[...]
Übersetzung: Hans Pleschinski
© Verlag C.H.Beck oHG, München
... weniger
Inhaltsverzeichnis zu „Nie war es herrlicher zu leben “
Ein Fürst stellt sich vor Junges Treiben
Tod in Wien
Deutsche Eindrücke
Kaiserwahl und Kaiserkrönung oder der Pomp des Alten Reiches
Abenteuerliche Reise nach Paris
Der betrübte König
Ein neuer Stern erstrahlt
Fastenzeit im Labyrinth der Macht
Ein eigener Beruf: Beharrlichkeit
Aachen und die verfluchten Ehren
Friedensfährnisse
Wintertreiben
Frühe Verwerfungen
Gefilde der Freuden oder die Lustmolkerei
Krieg zieht auf
Das Attentat
Neue Köpfe, alte Sorgen
Vater und Sohn
Ordensglanz
Die schwarzen Jahre
In ruhigeren Gewässern?
Klosterfrieden
Wieder im Leben
Ein Gestirn erlischt
Theater, Erben und der Stempel des Ministers
Pferderennen und Parlamentsaufruhr
Düsteres und Entzückendes am Horizont
Eine Dame, ein Bankrott und junges Glück aus Wien
Mätresse und Minister
Wilde Tiere, Pocken und die Dame
"Ich will nicht mehr denken."
Grausames Finale
"Vive le Roi!"
Kornrevolte
Der Glanz von Reims
Sparkurs mit Winterfreuden
Amerika brennt
Kaiserlicher Besuch
Voltaire und das Doppelwesen d'Eon
Hausball und Kampf um die Neue Welt
Voltaires letztes Gefecht
Eine Prinzessin, das Königspaar in Paris und Unglück in derKaribik
James Cook und Benjamin Franklin
Britannia in die Knie
Europabündnis, der Parkberg und die Dampfpumpe
Stille vor dem Sturm
Himmelwärts
Nachwort
Editorische Notiz
Dank
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Personenregister
Autoren-Porträt von Emmanuel de Croy
Hans Pleschinski, geboren 1956 in Celle, Studium der Germanistik, Romanistik und Theaterwissenschaften in München. Arbeit für Galerien, die Oper und den Film. Seit 1985 Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk und lebt als freier Autor in München. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise: u.a. Staatlicher Förderpreis für Schriftsteller in Bayern (1986), Tukan-Preis der Stadt München (1995), Hannelore Greve Literaturpreis (2006), Nicolas Born- Preis (2008) und den Ernst Hoferichter-Preis (2012).
Bibliographische Angaben
- Autor: Emmanuel de Croy
- 2011, 4. Aufl., 428 Seiten, 25 Abbildungen, Maße: 15,2 x 22,3 cm, Gebunden, Deutsch
- Herausgegeben: Hans Pleschinski
- Verlag: Beck
- ISBN-10: 3406621708
- ISBN-13: 9783406621703
- Erscheinungsdatum: 18.07.2011
Pressezitat
"Diese Lebenserinnerungen machen Geschichte lebendig."Helmut Krausser, Bücher, Oktober 2013
"Ein historisches Buch, das man wie ein unerwartetes Geschenk in den Händen hält und das den Leser beglückt zurücklässt."
Deutschlandradio Kultur, Lesart, 17. Mai 2012
"In dem insgesamt aus 41 Bänden bestehenden Werk, das Pleschinski zu einem hochspannenden Buch von etwas mehr als vierhundert Seiten verdichtet hat, zeigt sich der Herzog als ein knapp formulierender, aber begeisterter Beobachter seiner Zeit, auch was die Hochzeitspolitik angeht, die, so Pleschinski, eine 'Börsenpolitik' war."
Lena Bopp, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Mai 2012
"Pleschinski ist eine echte Trouvaille gelungen, sein Buch ist Herausgeber- und Übersetzerleistung zugleich. Das Tagebuch des Herzogs von Croy ist eine einzigartige Quelle für den Alltag am französischen Königshof unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. Glänzend beobachtet, in schlankem Französisch geschrieben, in elegantes Deutsch gebracht."
Jury des Preises der Leipziger Buchmesse, Februar 2012
"Die in größerem Umfang erstmals auf Deutsch veröffentlichten Memoiren bereichern unsere Kenntnisse über das adlige Leben im Frankreich vor 1789 ungemein."
Damals, 1/2012
"Es entsteht das Lebensbild eines Mannes, der in einer Epoche, die zum Inbegriff von Verschwendung, Intrige und Selbstsucht geworden ist, mit Umsicht die Geschicke der ihm Anvertrauten führte."
Der Spiegel, 17. Dezember 2011
"Die Erinnerungen des Herzogs von Croy bieten sehr viel mehr als kuriose Streifzüge durch das Gelände des 18. Jahrhunderts. Sie nehmen uns auf eine sonderbare Zeitreise mit. (...) [Hans Pleschinski] verdanken wir eine hervorragend lesbare deutsche Übersetzung, bei der sich im Detail bemerkbar macht, dass hier ein Experte für Schriften des 18. Jahrhunderts am Werke ist. (...) Offensichtlich war der Herzog von Croy vom Theater der Welt und von der menschlichen Komödie einfach ergriffen. 250 Jahre später ist nichts
... mehr
davon verblasst."
Walter van Rossum, Die Zeit, 8. Dezember 2011
"Große Memoirenliteratur des 18. Jahrhunderts, das deutsche Gegenstück zu St. Simon und Mme de Sévigny, voll Esprit und Melancholie."
Jens Jessen, Die Zeit, Weihnachtsempfehlungen, 1. Dezember 2011
"Ein so schön zu lesendes, historisch so interessantes und dabei menschlich berührendes Buch eines offenbar ebenso angenehm wie nachdenklichen Menschen findet man, auch unter Tagebüchern, selten. (...) Hier wird der Leser von dem unabhängigen Geist des Herzogs von Croÿ auf das Schönste überrascht."
Cord Aschenbrenner, Neuer Zürcher Zeitung, 16. November 2011
"Eine Trouvaille, eine Verlagsgroßtat: Mit seinem Tagebuch reiht sich der Herzog von Croÿ (1718-1784) unter den großen Diaristen des 17. und 18. Jahrhunderts ein, neben Samuel Pepys und Saint-Simon. Croÿs Jourmal, in der Auswahl und Übersetzung durch Hans Pleschinski erstmals auf Deutsch zugänglich, ist eine Fundgrube für das höfische und kulturelle Leben im vorrevolutionären Frankreich. Der Herzog scheint keinen langweiligen Tag verlebt zu haben."
Sigrid Löffler, SWR-Bestenliste, 30. September 2011
"41 handschriftliche Bände umfassen die Memoiren des Herzogs von Croÿ. Als Meister der Beobachtung und Selbstbeobachtung vermittelt der Offizier, Höfling und Privatgelehrte ein höchst lebendiges Bild vom Leben am Hof Ludwig XV. und Ludwig XVI. Einer Zeit, als die Weltmacht Frankreich vom Bett aus regiert wurde. (...) Dieses Buch ist so hinreißend und bemerkenswert (...). Hans Pleschinski (...) verdanken wir eine hervorragend lesbare deutsche Übersetzung, bei der sich im Detail bemerkbar macht, dass hier ein Experte für Schriften des 18. Jahrhundert am Werke ist."
Walter van Rossum, Deutschlandfunk, 25. September 2011
"Dem Herausgeber Hans Pleschinski sei Dank. Er hat uns einen wunderbaren Schatz geborgen. Aus der Tiefe der Zeiten spricht zu uns der Herzog von Croÿ. Und siehe da, unsere Vorstellungen vom Rokoko als Zeitalter der Frivolität und Tändelei, der Genussucht und des Raffinements, sie geraten durch diesen Mann ganz schön ins Wanken. (...) Wenn es ein Memoirenwek gibt, uns das Dixhuitième, von dem uns mehrere Weltuntergänge trennen, näherzubringen, dann ist es das Tagebuch dieses sympathischen, gläubigen, neugierigen, nachdenklichen und bis ins Alter zum Staunen bereiten Herzogs von Croÿ. Welche Freude, seine Bekanntschaft zu machen!"
Tilman Krause, DIE WELT, 13. August 2011
"Eigentlich hat der Romancier Pleschinski einen Schatz entdeckt, den er als Philanthrop bereitwillig teilt. (...) Begegnungen mit Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Schilderungen der grauenvollen Hinrichtung des Königsattentäters Robert Francois Damiens, der Liebschaften und des qualvollen Sterbens Ludwigs XV. machen die Tagebücher zu einem erstrangigen Dokument einer vergangenen, aber nachwirkenden Welt."
Wolfgang Burgdorf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. August 2011
"Der Bücherherbst hat gerade erst begonnen. Und doch riskiert der Rezensent zu behaupten: Das ist eines der schönsten historischen Bücher dieses Jahres."
Stephan Speicher, Süddeutsche Zeitung, 4. August 2011
"Gut anderthalb Jahre recherchierte er in Archiven in Paris und Dülmen, denn der Herzog und spätere Marschall entstammte einer Familie mit nordfranzösisch-westfälischen Wurzeln. Das Ergebnis ist ein wunderschön ausgestattetes Buch mit zeitgenössischen Illustrationen."
Katrin Hillgruber, Süddeutsche Zeitung, 21. Juli 2011
Walter van Rossum, Die Zeit, 8. Dezember 2011
"Große Memoirenliteratur des 18. Jahrhunderts, das deutsche Gegenstück zu St. Simon und Mme de Sévigny, voll Esprit und Melancholie."
Jens Jessen, Die Zeit, Weihnachtsempfehlungen, 1. Dezember 2011
"Ein so schön zu lesendes, historisch so interessantes und dabei menschlich berührendes Buch eines offenbar ebenso angenehm wie nachdenklichen Menschen findet man, auch unter Tagebüchern, selten. (...) Hier wird der Leser von dem unabhängigen Geist des Herzogs von Croÿ auf das Schönste überrascht."
Cord Aschenbrenner, Neuer Zürcher Zeitung, 16. November 2011
"Eine Trouvaille, eine Verlagsgroßtat: Mit seinem Tagebuch reiht sich der Herzog von Croÿ (1718-1784) unter den großen Diaristen des 17. und 18. Jahrhunderts ein, neben Samuel Pepys und Saint-Simon. Croÿs Jourmal, in der Auswahl und Übersetzung durch Hans Pleschinski erstmals auf Deutsch zugänglich, ist eine Fundgrube für das höfische und kulturelle Leben im vorrevolutionären Frankreich. Der Herzog scheint keinen langweiligen Tag verlebt zu haben."
Sigrid Löffler, SWR-Bestenliste, 30. September 2011
"41 handschriftliche Bände umfassen die Memoiren des Herzogs von Croÿ. Als Meister der Beobachtung und Selbstbeobachtung vermittelt der Offizier, Höfling und Privatgelehrte ein höchst lebendiges Bild vom Leben am Hof Ludwig XV. und Ludwig XVI. Einer Zeit, als die Weltmacht Frankreich vom Bett aus regiert wurde. (...) Dieses Buch ist so hinreißend und bemerkenswert (...). Hans Pleschinski (...) verdanken wir eine hervorragend lesbare deutsche Übersetzung, bei der sich im Detail bemerkbar macht, dass hier ein Experte für Schriften des 18. Jahrhundert am Werke ist."
Walter van Rossum, Deutschlandfunk, 25. September 2011
"Dem Herausgeber Hans Pleschinski sei Dank. Er hat uns einen wunderbaren Schatz geborgen. Aus der Tiefe der Zeiten spricht zu uns der Herzog von Croÿ. Und siehe da, unsere Vorstellungen vom Rokoko als Zeitalter der Frivolität und Tändelei, der Genussucht und des Raffinements, sie geraten durch diesen Mann ganz schön ins Wanken. (...) Wenn es ein Memoirenwek gibt, uns das Dixhuitième, von dem uns mehrere Weltuntergänge trennen, näherzubringen, dann ist es das Tagebuch dieses sympathischen, gläubigen, neugierigen, nachdenklichen und bis ins Alter zum Staunen bereiten Herzogs von Croÿ. Welche Freude, seine Bekanntschaft zu machen!"
Tilman Krause, DIE WELT, 13. August 2011
"Eigentlich hat der Romancier Pleschinski einen Schatz entdeckt, den er als Philanthrop bereitwillig teilt. (...) Begegnungen mit Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin, den Brüdern Montgolfier, Porträts von Madame de Pompadour bis zu Marie Antoinette, die Schilderungen der grauenvollen Hinrichtung des Königsattentäters Robert Francois Damiens, der Liebschaften und des qualvollen Sterbens Ludwigs XV. machen die Tagebücher zu einem erstrangigen Dokument einer vergangenen, aber nachwirkenden Welt."
Wolfgang Burgdorf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. August 2011
"Der Bücherherbst hat gerade erst begonnen. Und doch riskiert der Rezensent zu behaupten: Das ist eines der schönsten historischen Bücher dieses Jahres."
Stephan Speicher, Süddeutsche Zeitung, 4. August 2011
"Gut anderthalb Jahre recherchierte er in Archiven in Paris und Dülmen, denn der Herzog und spätere Marschall entstammte einer Familie mit nordfranzösisch-westfälischen Wurzeln. Das Ergebnis ist ein wunderschön ausgestattetes Buch mit zeitgenössischen Illustrationen."
Katrin Hillgruber, Süddeutsche Zeitung, 21. Juli 2011
... weniger
Kommentar zu "Nie war es herrlicher zu leben"



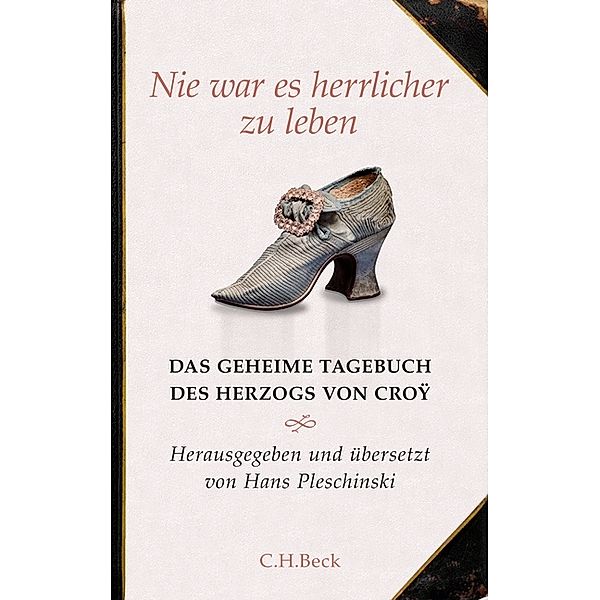
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Nie war es herrlicher zu leben".
Kommentar verfassen